…eine laaaaaange(!) Sammlung über mögliche wohltuende Auswirkungen unserer Verbindung zur Natur, aufgeschrieben von Elke Loepthien-Gerwert.
Leben im Ausnahmezustand ist anstrengend und ernstlich zehrend – unglaublich viele Menschen litten in den letzten 1,5 Jahren unter seelischem Dauerstress und der damit verbundenen zunehmenden emotionalen und körperlichen Erschöpfung.
Die Natur, die uns umgibt kann uns ein ganzes Stück weit auffangen, wie Forschende seit Jahren dokumentieren. Vieles kann sogar mitten in der Stadt funktionieren!
Hier unsere 31 wichtigsten Aspekte & Zutaten dazu:
1. Natur macht streifenfrei entspannt
Allein der Ausblick aus dem Fenster in eine natürliche Landschaft oder der Anblick von Naturfotos lassen uns schon wohler fühlen und beispielsweise nach Operationen schneller wieder gesund werden. Dies könnte unter anderem daran liegen, dass unsere lebendige Mit-Welt hat eine bestimmte räumliche Struktur aufweist, die wie Forschende es nennen „beliebig skalierbar“ ist. Das bedeutet: Egal wie weit wir herauszoomen oder hineinzoomen: Immer erkennen wir dieselbe Anzahl von Details – das können Blätter an einem Baum sein oder wenn wir ganz nah herangehen die feinen Linien, Poren und Unebenheiten auf einem einzelnen Blatt oder die winzigen Gliedmaßen einer Blattlaus.
Um diese zu verarbeiten würde unser Gehirn nur wenig Neuronentätigkeit brauchen, es gehe also leicht, schreibt der Neurologe Richard E. Cytowic. Im Gegensatz dazu zeigten unnatürliche Bilder in großer Vergrößerung kaum noch Details. Je weniger skalierbar ein Bild ist, desto unangenehmer ist es zu betrachten – sogar messbar! Auch starke Farb-Kontraste sind anstrengend zu verarbeiten.
Dabei scheinen Streifenmuster besonders unerträglich. Und wo finden die sich? Überall um uns herum: Gebäude, Straßen, Treppenstufen, Gänge, Türen, Fenster und nicht zu vergessen: Text, der fast immer in Zeilen geschrieben ist und dessen Wahrnehmung besonders erschöpfend sein kann.

2. Natur spielt die Lieder des Lebens
Auch die Geräusche der Natur können Stress reduzieren, beispielsweise weist eine Studie darauf hin, dass wir uns bei natürlichen Geräuschen, in diesem Fall dem Sprudeln einer Quelle verbunden mit Vogelgesang, nach aufregenden Aktivitäten schneller beruhigen könnten.
Eine mögliche Begründung dafür, die in einer anderen Studie beschrieben wurde, sei es, dass unsere Aufmerksamkeit ins Außen wandern würde, wenn wir Geräusche aus der Natur hörten. Dagegen würde sich die Aufmerksamkeit vorwiegend nach Innen richten, wenn wir Menschengemachtes anhören – und diese Art des nach Innen wanderns käme dem nahe, was Menschen im Zustand von Depressionen erleben.
Interessant zu bemerken war hier die ausgleichende Wirkung von Naturgeräuschen: Menschen die gestresst ins Experiment gingen, entspannten sich am stärksten. Wohingegen Menschen, die in einem sehr entspannten Grundzustand die Naturgeräusche anhörten, davon sogar angeregt wurden.
In einer Auswertung von 18 einzelnen Studien wurde festgestellt, dass Anzeiger für Stress und Genervtsein abnahmen, Schmerzen weniger wurden, der Puls sank und der Blutdruck abnahmen, außerdem die Laune und kognitive Fähigkeiten sich verbesserten.

3. Grün tut gut
Wir nehmen Farben wahr, wenn Licht unterschiedlicher Wellenlängen in unser Auge eindringt. Rot hat die längste Wellenlänge, und sei deshalb aufwendiger anzuschauen – Grün dagegen könnten wir vollkommen mühelos wahrnehmen, weshalb es sich entspannend auf uns auswirke, schreiben Wissenschaftler in einer Studie über die Auswirkungen von Farben auf Studierende. Neben der individuell ganz verschiedenen Bedeutung, die Menschen bestimmten Farben geben, gäbe es bestimmte physiologische Auswirkungen, die sich verallgemeinern lassen: Grün wird zu den emotional beruhigenden Farben gezählt und würde insbesondere dabei helfen, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen, weswegen in öffentlichen Gebäuden wie Restaurants oder Hotels häufig Grün verwendet würde.
In anderen Studien wurde festgestellt, dass Grün die Angst vor Versagen mindern konnte, sich ausgleichend auf die Stimmung beim Sport auswirkte und vor allem, dass ein kurzer Blick auf etwas Grünes vor einer Aufgabenstellung die Kreativität beim Lösen derselben erhöhte.

4. Die Aussicht darauf, versorgt zu sein
Eine Vermutung für die Ursache dieser Effekte ist, dass das Vorhandensein von viel Grün in der Umgebung für uns als ursprünglich nomadisch herumziehende Menschen schon immer ein klares Signal dafür war, dass ein Ort grundsätzlich ausreichend Wasser und Nahrung bieten könne – er sich also zum Verweilen eignen würde.
Vielleicht könnte dies auch der Grund dafür sein, warum wir uns in artenreicher Natur wohler fühlen – faszinierender Weise aber nur dann, wenn wir diese Artenvielfalt auch selbst wahrnehmen und erkennen können!
Eine wertvolle Fertigkeit ist es also, feine Unterschiede wahrnehmen zu lernen – wofür der nächste Punkt hilfreich sein kann:

5. In der Natur unterwegs sein weckt die Katze in uns
Aufgrund der menschlichen Ausstattung mit Betonung des Sehsinns ist unsere natürliche Art der Fortbewegung kein einförmiges Trotten mit gesenktem Kopf, wie wir es von Hundeartigen kennen, oder von unserem eigenen eiligen, unaufmerksamem Laufen entlang alltäglicher Wege.
Eher laufen wir wie eine Katze von A nach B, die sich unterwegs Zeit lässt, viel umherschaut, oft stehen bleibt, sich umdreht oder sogar hinsetzt und ihre Umgebung sorgfältig betrachtet.
Durch die Natur laufend, besonders wenn wir länger draußen sind oder an einem neuen Ort (oder eben mit Neugier-Blick an einem bekannten Ort), ergibt es sich leichter, in Ruhe und genüsslich in alle Richtungen zu schauen, stehen zu bleiben, uns umzudrehen, den Boden unter uns und den Himmel über uns zu betrachten und dabei wahr zu nehmen, was wir sehen: Formen, Farben, Bewegung, Licht und Schatten und Details, die wir identifizieren können (Bäume, Blüten, Blätter, Wege oder was auch immer wir entdecken können).
Bei dieser Art des Umherschauens, die beispielsweise in manchen Formen der Trauma-Therapie genutzt wird, beruhigt sich unser Nervensystem, denn die Handlung des sich ganz in Ruhe Orientierens an sich signalisiert schon, dass alles in Ordnung ist, ebenso versichern wir uns, dass reale Gefahren gerade nicht zu entdecken sind, und wir betrachten lauter Sachen, deren Anblick uns zusätzlich gut tut, vor allem wenn wir dabei etwas „Besonderes“ entdecken, das unser natürliches Belohnungssystem aktiviert…

6. Genau die richtige Menge Dopamin
Wann immer uns etwas gelingt, das unser Überleben fördert, belohnt uns unser Körper dafür: Beim Jagen oder Sammeln, wenn wir neue Erkenntnisse haben, oder uns frisch verlieben, schütten wir Dopamin als Botenstoff aus und spüren dabei freudige Erregung, Motivation und Glücksgefühle.
Was in unserem natürlichen Lebensraum ein ausgefuchstes System zur Förderung eines selbstbestimmten, erfüllten Lebens voller Lernen und Wachstum ist, macht uns in unserem technisierten Alltag eher zu Sklaven der Konsumgesellschaft:
Werbespots und Billboards, Computerspiele und schnell zugängliche Informationen, lockende Schaufenster mit buntem Spielzeug oder den allerneusten Handys, erotische Fotos von heißen Models – tagein tagaus werden wir bombardiert mit Zeugs, das unsere Dopaminausschüttung stimuliert, wodurch der auslösende Reiz abgenutzt wird und wir in ein suchtartiges Mehr-und-Mehr-davon-Wollen hineinverlockt werden.
In der Natur warten auch Dopamin-Momente:
Wenn wir eine sich gerade öffnende Blüte im Park entdecken, Himbeeren am Waldrand sammeln, endlich den Vogel erspähen, dessen Gesang wir schon länger neugierig gelauscht hatten, wenn sich ein Großstadt-Fuchs im Vorbeigehen zu uns umdreht, wir es schaffen, ein Feuer zu entzünden oder wir am Rande der Pfütze eine winzig kleine Tierspur entdecken.
Dabei bringen diese Erlebnisse ganz andere Qualitäten mit sich, als die menschengemachten Dopamin-Kicks:
-
das auslösende Erlebnis passiert viel seltener – oftmals ist es einzigartig
-
Wiederholungen sind nicht oder nicht lange kontrollierbar
-
für viele davon braucht es energieintensive Vorbereitung und ein geduldiges daraufhin Arbeiten
-
wenn wir uns überreizt fühlen, können wir selbst leicht dosieren, wie viel wir wahrnehmen wollen, entsprechend unseres Neugier-Levels in dem Moment (während wir in der U-Bahn, beim Einkaufen und vor dem TV meistens keine Wahl haben)
Mit Natur interagieren macht es also leicht, die für uns gerade richtige Menge Dopamin auszuschütten, in einem Takt, der unserer körperlichen und seelischen Verfassung entspricht und den wir selbst regulieren können.

7. Fokus-Kraft (wieder) finden
Technologie macht unser Leben vor allem eines: Schneller!
Vieles wird dank ihr wesentlich leichter und einfacher – doch die frei gewordene Zeit scheint sich oft direkt neu zu füllen mit einfach mehr, so viel mehr.
Indem wir wissen, was überall auf der Welt los ist und dank unserer Gadgets beständig nebenbei Informationen aufnehmen und kommunizieren können, läuft unser Gehirn auf Hochtouren – bis an die Belastungsgrenze.
Wir überfordern uns selbst und das was wir gleichzeitig mit noch irgendetwas anderem tun, machen wir nicht mehr ganz so gut – wie beispielsweise Autofahren während wir jemand anderem zuhören, was in einer Studie die Hirnaktivität im Areal zum Verarbeiten des Streckenverlaufs um ganze 37 % verminderte.
Tatsächlich waren in Multitasking geübte Personen in einer anderen Studie sogar weniger gut darin, das zu tun, was sie eigentlich am besten können sollten: Von einer Aufgabe zur nächsten zu wechseln. Vermutet wurde dabei, dass ihr überlasteter Denkapparat einfach nicht so gut herausfiltern konnte, welche Aspekte eigentlich relevant waren und welche nicht.
Dauerndes mediales Multitasking (also das Konsumieren von mehreren Medien gleichzeitig) scheint außerdem eine sichere Zutat für Depressionen und soziale Ängste zu sein, und in einer besonders alarmierenden Studie wurde aufgezeigt, dass Menschen, die besonders viel medial multitasken tatsächlich eine verminderte Dichte in einem Bereich des Gehirns aufweisen, der wesentlich zur Verarbeitung gedanklicher und emotionaler Prozesse und zum sich innerlich motiviert fühlen beiträgt.
Multitasking kann im Grunde also einen regelrechten Teufelskreis erzeugen, indem es uns noch leichter ablenkbar machen kann – so dass wir weniger in der Lage sind, angesichts einer herausfordernden Situation überhaupt zu bemerken, was wichtig und was unwichtig ist.
Deshalb brauchen wir umso dringlicher Zeiten, wo unser Gehirn und unser Nervensystem sich von den vielen gleichzeitigen, oder sich sehr schnell abwechselnden Inputs und Aufgaben erholen können.
Genau das passiert, wenn wir uns mit der Natur verbinden!
„Attention Restoration Theory“ ist ein wissenschaftliches Konzept, das die positiven Auswirkungen von Zeit in der Natur auf unser Denkvermögen beschreibt, insbesondere auf unser Kurzzeitgedächtnis, auf die Beweglichkeit gedanklicher Prozesse und auf unser Vermögen, unsere Aufmerksamkeit willentlich zu fokussieren.
Indem sich unser System in der Natur entspannt, können wir uns mental und emotional erholen, unser Stress-Pegel sinkt, wir können wieder klar denken und leichter bessere Entscheidungen treffen und uns kreativer verhalten.
In einer Studie der Universität Michigan konnte schon ein kurzer Spaziergang in der Natur oder selbst das Betrachten eines Natur-Fotos die Leistung des Kurzzeit-Gedächtnisses um etwa 20% verbessern .
Die Wirkung der „Attention Restoration“ merken wir vor allem, wenn wir länger draußen sind: Nach mehreren Tagen draußen in der Natur konnten Menschen verstandesmäßig lösbare Probleme um fast 50% besser bewältigen.
In einer anderen Studie wurde gezeigt, dass sich der Zugang zu Naturräumen auf die Fähigkeit von Großstadt-Kindern auswirken kann, verschiedene Aspekte von Selbst-Disziplin zu erleben, beispielsweise ihre Aufmerksamkeit auch angesichts von Ablenkungen oder Frustration willentlich fokussieren zu können.
Überhaupt haben sich Aktivitäten draußen als wirkungsvolle „Medizin“ gegen Aufmerksamkeitsdefizit-Störungen erwiesen – und das völlig unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen, Lebensort und anderen Faktoren.
Aber warum ist das so?
Ist die Welt unserer Mit-Wesen nicht voll mit unzähligen ebenfalls gleichzeitig laufenden Ereignissen, die wir über Geräusche und visuellen Eindrücke in uns aufnehmen, und die unsere Aufmerksamkeit mindestens genauso herausfordern und regelrecht stressen müssten?
Ich glaube, dass die Komplexität des vollen Lebens im Ökosystem für uns entspannend sein kann, weil es sich dabei nicht um lauter voneinander losgelöste einzelne Teile handelt, jedes mit einer eigenen „Agenda“, sondern alle Vorgänge in ein sinnvolles Ganzes eingebunden sind – und wir selbst, indem wir da draußen sitzen oder herumlaufen, ganz genauso.
Demnach wären wir in der Natur vielleicht nicht mit vielen Gegenübern und Aufgaben gleichzeitig konfrontiert, sondern nur mit einer einzigen Sache: Einfach mit unserem Da-Sein inmitten der Erdengemeinschaft hier an diesem Ort.

8. Bedingungsloses Willkommen – fernab von Karrieredruck & Konventionen
Im Erleben oder auch nur Betrachten von Natur erlischt der Stress in unserem Körper, schon innerhalb von wenigen Minuten.
Ich glaube ein wesentlicher Grund dafür könnte die Abwesenheit der unglaublich vielen, komplexen und teilweise einander sogar widersprechenden sozialen und gesellschaftlichen Anforderungen sein, die sich insgesamt kaum jemals erfüllen lassen.
In der Natur können wir all das vielleicht ein Stück weit hinter uns lassen und wieder in Verbindung mit uns selbst kommen, mit dem was uns persönlich wirklich wichtig ist.
Begegnen wir unseren natürlichen Mit-Wesen, kann etwas von dem destruktiven und oft völlig sinnlosen Druck von uns abfallen, der uns im Alltag so stark belastet: Um mit Bäumen, Wiesenblumen oder Schnecken zusammenzusein, brauchen wir keine guten Noten, keine erfolgreichen Projekte, keine den Idealen der Zeit entsprechenden Körperformen, keine besonders witzigen oder geistreichen Gedanken, nicht mehr Geld auf dem Konto oder noch mehr Likes in den sozialen Medien… wie und wer auch immer wir gerade sind, ist es genug.
Vielleicht fällt es uns leichter, das anzunehmen, wann immer wir in Kontakt sind mit anderen Lebewesen, die sich nicht um gesellschaftliche Konventionen und Leistungsdruck scheren, sondern einfach ihr Leben leben.
Eine wichtige Grunderfahrung
So helfen sie uns dabei, eine wichtige Grunderfahrung nachzuholen und weiter zu stärken, die vor allem in den allerersten Lebensjahren essentiell für eine gesunde seelische Entwicklung ist: Dass wir willkommen sind, wie auch immer wir (gerade) sind oder nicht sind, unabhängig von unserem Aussehen, unserer Leistungsfähigkeit, unserer Bereitschaft uns anzupassen und vielem anderen mehr (etwas das selbst die liebevollsten Eltern nicht immer für ihre Kinder schaffen können).
Wenn wir uns draußen außerdem gewahr werden, dass unsere gesamte Nahrung, alle unsere Kleidung, unser Wasser, unsere Behausungen, unser gesamter Körper und alles was wir besitzen von der Erde stammt, docken wir an das in Europa mindestens 200.000 Jahre alte Verständnis von der Erde als unserer „Mutter“ an – aus der beständig alles Leben geboren wird und die auch uns als Menschen immerfort nährt.
Egal wie erwachsen wir schon sind oder gern sein wollen, ob unsere leibliche Mutter noch lebt oder nicht – die Möglichkeit mit einer immer präsenten „Mutter Natur“ in Kontakt treten zu können, die überhaupt gar nichts von uns einfordert, kann (in Psychotherapie-Sprache) eine enorme Ressoure für unsere seelische Gesundheit sein.
Wenn wir uns mit der „großen Mutter“ verbinden, bekommen wir Rückenstärkung um unsere inneren kindlichen Anteile zu nähren und liebevoll zu halten – und uns dadurch insgesamt geborgener in der Welt zu fühlen, ohne dass wir beständig etwas für unsere Sicherheit tun oder leisten müssten.
Mit dieser „Grundversorgung“ fällt es auch leichter, ganz wie von selbst auf eine der destruktiveren menschlichen Angewohnheiten zu verzichten:

9. In der Natur kann Grübeln verblassen
Grübelei („rumination“) wird als über lange Zeiträume fehlgeleitete Konzentration auf mögliche Ursachen und Konsequenzen von Emotionen beschrieben, wobei es sich meist um als negativ erlebte Emotionen in Beziehung zu sich selbst handelt. Tritt Grübelei auf, kann sie ein Frühanzeichen für depressive Episoden und andere seelische Störungen sein.
In einer Studie in der Umgebung der Stanford University wurde festgestellt, dass ein 90minütiger Spaziergang in der Natur bei den Teilnehmenden Personen Grübeleien deutlich reduzierte.
Was kann der Grund dafür sein?
Beim Grübeln reisen wir mental dauerhaft oder wechselnd in die Vergangenheit oder Zukunft – während der Aufenthalt in der Natur uns scheinbar immer wieder in den Moment zurückholen kann.
Wie weiter oben schon besprochen kann sich so ein Moment in der Natur subjektiv viel sicherer und geborgener anfühlen als beispielsweise bei einem Spaziergang durch die Stadt möglich wäre, so dass es leichter möglich sein könnte, in diesem viel tröstlicheren Hier und Jetzt zu bleiben.
Zusätzlich könnten auch die intensiven physischen Empfindungen, die in der Natur oft leichter möglich sind, uns helfen ganz im Moment zu bleiben,

10. Den Körper spüren – aufmerksam
Die Sinneseindrücke, die unser Körper draußen geschenkt bekommt, können uns dabei helfen, uns selbst bewusster zu spüren, v.a. wenn wir unsere Aufmerksamkeit beständig darauf ausrichten, mehr und intensiver wahrzunehmen – eine wichtige Praxis für Naturverbindung.
Den Wind zart unser Gesicht streicheln zu fühlen, die Textur des Bodens unter uns, wenn wir barfuß oder mit dünnen Sohlen über Wiesen, feuchte Stellen, Waldboden laufen, Moose, Kräuter, Baumrinden und vieles mehr mit unseren Händen bewusst zu berühren, in kaltes Wasser einzutauchen und dabei den feuchten Sand des Bachbetts zwischen unseren Zehen zu spüren – all das und noch viel mehr kann es so viel leichter machen, nicht nur unsere Umgebung sondern automatisch auch unseren eigenen Körper viel stärker und aufmerksamer wahrzunehmen – ein Grundelement vieler Meditationspraxen.
Meditation allgemein hat zahlreiche bereits wissenschaftlich nachgewiesene Auswirkungen auf unsere seelische (und körperliche) Gesundheit: Höhere Resilienz gegen Stress, verbesserte Impuls- und Selbstkontrolle, verringerte Anfälligkeit für Süchte, ein insgesamt „beweglicheres“ Gehirn das in der Lage ist, besser auch im Alter neue Neuronen-Verbindungen aufzubauen und Linderung von belastenden körperlichen Schmerz-Zuständen. (Im Artikel wird auch auf mögliche negative Effekte eingegangen, und Empfehlungen gegen wie diese verhindert werden könnten.)
Vereinfacht könnten wir sagen, dass Meditation unserem Gehirn dabei hilft, zu reifen. In Studien über die Effekte eines achtwöchigen Meditations-Kurses war dies sogar physisch messbar, als zunehmende Dichte in der „grauen Masse“, vor allem in Bereichen die für Lernen, Gedächtnis, Selbst-Wahrnehmung, Mitgefühl und Innenschau und weniger Dichte im Bereich der Amygdala – die beim Auslösen von Überlebensreaktionen aktiv wird.
Verbinden wir uns mit anderen natürlichen Wesen um uns herum, kann hier ein weiterer Aspekt noch zusätzlich unterstützen:

11. Resonanz hilft regulieren
Unser Nervensystem ist bei Dauerstress beständig in einem leichten (oder manchmal auch sehr ausgeprägtem!) Kampf-oder-Flucht-Modus gefangen, so dass es manchmal schwer erscheint, überhaupt wieder „runterzukommen“. In der Natur zu sein hilft uns, wieder in die Entspannung zu finden.
Ein Grund dafür könnte die Fähigkeit unseres Körpers sein, in Stress-Situationen an einem anwesenden entspannteren Nervensystem „anzudocken“, indem wir in Resonanz mit diesem Gegenüber gehen. Dieses Phänomen ist bisher vor allem für das Verhältnis zwischen Eltern und kleinen Kindern oder auch Klienten und Therapeut*innen beschrieben worden, aber auch in der tiergestützten Therapie mit Hunden, Pferden, Delphinen usw. beobachtbar.
Meiner Erfahrung nach ist dieses Andocken mit fast allem möglich, was uns draußen begegnet: Mit Bäumen, Kräutlein, Insekten, Vögeln, sogar mit Gewässern oder Steinen. Wir können uns dafür bewusst in jemand anderen hineinversetzen, beispielsweise indem wir die Frage stellen: „Wie ist es, du zu sein?“ (die ich so erstmalig von Charles Eisenstein gehört habe), und dann einfach wahrnehmen, was wir in uns selbst fühlen, hören, sehen, spüren können.
Unser Nervensystem überprüft möglicherweise unbewusst beständig unsere Umgebung darauf, ob sie „sicher“ genug ist – denn es ist darauf ausgerichtet, unser Überleben zu sichern. Bei kleinen Kindern entsteht das Gefühl von Sicherheit unter anderem durch die Nähe zu sich selbst sicher fühlenden, entspannten und aufmerksam auf das Kind eingestimmten Eltern.
So lernen wir vielleicht von Anfang an, Zustände von Stress oder Entspannung in anderen wahrzunehmen und uns daran zu orientieren, wenn es darum geht, wie sicher wir uns selbst fühlen.
In der Natur findet unser Nervensystem (zumindest meistens) eine Menge entspannter und jedenfalls gut regulierter, aufmerksamer Wesen.
Besonders leicht für uns wahrzunehmen ist die Entspannung bei den Singvögeln: Während sie in ihrer „Baseline“ sind, also singen, sich putzen, nach Nahrung suchen oder ihr Nest bauen, spürt auch unser Nervensystem instinktiv, dass gerade keine Gefahr herrscht. Auch zirpende Grillen zeigen ein Entspanntsein an. Hören wir dagegen die atemlose Stille oder fiependen Alarmrufe wenn ein Sperber oder Habicht in der Nähe ist, lässt sich die Anspannung auch in unserem Körper spüren.
Insofern könnte es noch entspannender sein, unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen Wesen in unserer Mit-Welt zu richten, die vielleicht das ruhigste oder zumindest langsamste Leben draußen führen: die Bäume.

12. Bäume als Buddies?
Tatsächlich scheint das Wahrnehmen von Bäumen unser parasympathisches Nervensystem zu stärken, welches Entspannung in den Körper bringt. In einer Studie in Chicago wurde sogar festgestellt, dass pro 10% mehr an Baumwipfel-Bedeckung in Gebieten der Stadt die jeweilige Rate gewalttätiger Übergriffe im selben Gebiet um mehr als 10% sank.
In einer anderen Studie mit Erwachsenen hier in Deutschland in Berlin, wurde festgestellt, dass Menschen insbesondere in der Nähe von Waldgebieten eine gesündere, entspanntere Aktivität der Amygdala aufwiesen, eines recht kleinen Teils unseres Gehirns, welcher maßgeblich am Auslösen von Überlebensreaktionen mitwirkt.
Warum aber hat gerade der Wald so starke positive Effekte auf uns?
Vermutlich hat es damit zu tun, dass im Wald so viele Bäume wachsen.
In den letzten Jahren erforscht wurden im Erforschen der gesundheitlichen Effekte der ursprünglich japanischen Praxis des Waldbadens die sogenannten Phytoncide, beschrieben, abwehrstärkende Duftstoffe, die von Bäumen verströmt werden und sich nicht nur auf das Immunsystem auswirken, sondern u.a. die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin vermindern und antidepressiv wirken.
Bäume sind wirklich erstaunliche Wesen, die oftmals viel viel älter als wir selbst sind. Ich glaube, dass ein Teil in uns instinktiv weiß, dass wir es hier im wahrsten Sinne des Wortes mit „Ältesten“ zu tun haben, deren Lebenserfahrung auf eine Weise die unsere weit übersteigt.
Vielleicht ist dies der Grund dafür, dass Bäume intensive Gefühle von Ehrfurcht in uns auslösen können.

13. In der Natur Ehrfurcht erleben
Ehrfurcht ist das Erleben von etwas Großartigem, das unser rationales Vermögen, die Welt zu verstehen übersteigt oder an seine Grenzen bringt. Es ist eine enorm wirkungsvolle Emotion, die wir unter anderem im Angesicht von Bäumen und beim aufmerksamen Erblicken anderen „Wunder“ der Natur erleben können, und die uns dazu führt, hilfsbereiter, kooperativer und großzügiger zu handeln. „Uns etwas Großartigem gewahr zu werden fördert ein bescheideneres, weniger narzistisches Selbst, dem mehr Nächstenliebe anderen gegenüber möglich ist.“ schreibt Dacher Keltner vom Greater Good Science Center der Universität in Berkeley.
Er erklärt weiter: „Kurze Erlebnisse von Ehrfurcht ermöglichen es uns, unser eigenes Selbstverständnis als Teil eines kollektiven Ganzen zu sehen, und sie richten unsere Handlungen auf das Wohl der anderen aus.“ Im Erleben von Ehrfurcht nehmen wir also unser Selbst als kleinen, jedoch fest verbundenen Teil von etwas Großem war, was sich deutlich auf unser Verhalten auswirkt.
Wenn das Wasser lebt
Wenn wir nun aber Personen aus indigenen Völkern zuhören, zeigt sich in den Worten die sie wählen, oft eine Ehrfurcht vor dem Leben, die nicht dem individuellen Erleben überlassen, sondern ein zentraler Bestandteil und Schwerpunkt von gemeinschaftlicher Kultur und Traditionen ist – wo die Erde und unsere Mit-Wesen als „heilig“ angesehen werden, voller „Geist“ und beseelt sind, und ebendiese ehrfurchtsvolle Auffassung über Generationen weiter genährt wurde und wird:
„Mir wurde beigebracht, dass das Wasser lebt. Es kann hören und Erinnerungen in sich halten. Deshalb habe ich heute ein Gefäß mit Wasser dabei, damit es die Erinnerungen an unser Gespräch heute in sich bewahren kann,“ (so eröffnete Kelsey Leonard, Wissenschaftlerin und Angehörige der Shinnecock Nation 2019 ihren TED-talk darüber, dass Gewässer dieselben Rechte haben sollten wie Menschen).
Ehrfurcht zu erleben hat gravierende Auswirkungen auf die seelische (und körperliche) Gesundheit. Cytokin ist ein Botenstoff unseres Körpers, der stressbedingten Entzündungen entgegenwirken soll, aber bei chronischem Stress in viel zu hoher Menge vorhanden sein kann, was chronische Schwäche und in Folge eine geringere Lebenserwartung zur Folge haben kann. Ein überfordertes Cytokin-System könnte eine Erklärung dafür bieten, warum Menschen, die unter materieller Armut leiden, oft besonders gravierende gesundheitliche Probleme haben.
In Versuchen ist Ehrfurcht bislang die einzige Emotion, die nachgewiesenermaßen einen regulierenden Effekt auf den Cytokin-Spiegel ausübt.
Gerade manche Bäume können jenseits der Ehrfurcht, die wir dank ihnen erleben können, auch noch auf andere Weise unser Seelenwohl fördern….

14. Zugehörigkeit durch Bindungs-Hormone
Viele Bäume, gerade solche in Städten und Parks können wir eindeutig als Individuen erkennen und leicht wieder erkennen. Sie können dadurch zu einzigartigen, echten Persönlichkeiten in unserem Leben werden, selbst wenn wir ihnen nur ein einziges Mal begegnen.
Schon lange beschäftigt mich und andere die Frage, ob man die für menschliche Beziehungen so essentielle Bindung („attachment“) nicht auch auf unsere Beziehung zur Natur übertragen kann? Sie scheint sich immer deutlicher mit Ja beantworten zu lassen: Wenn wir Tiere streicheln, schüttet unser Körper (und oft auch ihrer) Oxytocin aus, das sogenannte „Bindungs-Hormon“, das auch freigesetzt wird, wenn Mütter ihre Babies stillen oder wir mit geliebten, vertrauten Menschen kuscheln.
Meine Vermutung ist, dass ebendieses Hormon auch in uns aktiviert wird, wenn wir uns an geliebte Bäumen anlehnen, an Felsen, auf denen wir schon seit der Kindheit geklettert sind, oder mit den Fingern zart die Blüte eines Gänseblümchens streicheln – also wann immer wir selbst liebe-voll mit einem anderen (Lebe-)Wesen umgehen.
Denn wir können uns emotional und mitfühlend mit unseren Mitwesen verbunden fühlen.
Schützen was wir lieben
Ob Oxytocin in uns zu menschenfreundlicherem Verhalten führt, scheint in Studien davon abzuhängen, ob wir den Kontext in dem Moment insgesamt als sicher und geborgen oder eher als bedrohlich einschätzen. Denn im Falle einer Gefahr für uns selbst oder die als uns zugehörig erlebten Personen (Wesen), kann Oxytocin unser Schutzverhalten verstärken.
Dies könnte vielleicht auch erklären, warum Menschen eher bereit sind, sich für den Schutz der Umwelt einzusetzen, wenn sie sich selbst mit der Natur verbunden fühlen und Natur als beseelte anerkennen.
In jedem Fall könnten Bindungshormone und auch unsere Sicht auf die Natur als eine Welt voller uns gleichwürdiger, irgendwie mit uns verbundener Lebewesen es uns erleichtern, uns selbst als zu anderen zugehörig zu erleben.
Durch ein von uns aus zärtliches und liebe-volles in Verbindung treten mit unserer Mit-Welt können wir jeden Tag erleben, was Albert Schweitzer so eindrücklich in Worte gefasst hat: „Ich bin Leben inmitten von Leben, das Leben will.“
Diese Zugehörigkeit zu erfahren scheint eines der tiefsten menschlichen Grundbedürfnisse zu sein, eine Möglichkeit auf uns selbst und die Welt zu schauen, die wir instinktiv ersehnen.

15. Angst und Stress reduzierende „Alte Freunde“
Wenn wir draußen sind, vor allem wenn wir die Erde berühren und ihren Duft einatmen oder Pflanzen naschen, stärken wir dabei die Beziehung zu ganz besonderen „alten Freunden“ – Bakterien und andere Kleinstlebewesen, die für unsere Gesundheit von großer Bedeutung sind.
Beim engen Kontakt mit dem Erdboden können sie durch unsere Atemwege oder auch über den Mund aufgenommen werden.
Dabei geht es nicht nur um körperliches Wohlbefinden: Laut Christopher Lowry von der Universität in Colorado können beispielsweise die überall auf der Erde zu findenden „Schlammbakterien“ Mykobakterium vaccae nicht nur Entzündungen im gesamten Körper lindern oder verhindern, sondern Angst- und Stressreaktionen vermindern und dadurch sogar auch Traumata, und damit posttraumatischen Belastungsstörungen vorbeugen.
Zum einen wies Lowry nach, dass mit Mykobakterien gefütterte Mäuse eine bestimmte Aktivierung des Immunsystems, verbunden mit Abläufen im Hirnstamm aufweisen, welche sich wiederum auf die Abläufe im Stirnlappen und anderen Hirnregionen auswirken, wo unsere Stimmung und unser Verhalten reguliert werden.
Inspiriert von diesen Forschungen testete Dorothy Matthews die Wirkung von Mykobakterien auf das Lern- und Entdeckungsverhalten von Mäusen. Sie stellte fest, dass Mäuse nach der Einnahme von Mykobakterien mit deutlich weniger Angst und Stress den Weg durch ein Labyrinth finden können und sogar wesentlich schneller. In ihren Experimenten hielt die Wirkung der eingenommenen Bakterien etwa eine Woche lang messbar an.
Schutz vor Traumatisierung
In Christopher Lowry’s weiteren Versuchen befähigte die Verabreichung der Bakterien die Labor-Mäuse sogar dazu, aktiver mit schlimmen Stress-Erlebnissen umzugehen, beispielsweise wenn sie ohne Fluchtweg dem Angriff eines überlegenen Männchens ausgesetzt wurden, was meist zu Traumatisierungen führe.
Die dank Mykobakterien weniger passive, sondern aktivere Reaktion der Versuchsmäuse (sie versuchten aktiv zu kämpfen oder zu flüchten) bewirkte, dass diese später nicht unter den normalerweise auftretenden posttraumatischen Belastungsstörungen litten.
Dieser Zusammenhang ließ Lowry vermuten, dass Mykobakterien auch Menschen dabei helfen könnten, unsere Resilienz gegenüber potentiell traumatischen oder auch einfach sehr stressvollen Erlebnissen zu stärken.
Schon 2004 hatte Mary O’Brian bewiesen, dass eine Behandlung mit Mykobakterien bei Menschen mit Lungenkrebs deren emotionale Gesundheit drastisch verbesserte: Sie fühlten sich insgesamt wohler und auch ihre kognitiven Fähigkeiten wurden verbessert.
Die Mykobakterien sind nur ein kleines Beispiel dafür, wie inniglich unser Sein verbunden ist mit Wesen, die vollkommen anders sind als wir Menschen, ja sogar von uns übersehen werden – und von denen wir selbst und die Gesundheit unserer inneren und äußeren Ökosysteme doch zutiefst abhängig sind.

16. Wert-Schätzen & Dankbarkeit für die Natur
Mich mit der Natur verbinden bedeutet, nicht nur auf der Wissens-Ebene, sondern auch durch persönliche Erfahrung immer neu und noch mehr darüber zu lernen, was zum Lebensgeflecht auf der Erde alles dazu gehört – und wie unglaublich wichtig das alles ist.
Ich lerne dabei, den Wert des Lebens zu achten, dankbar dafür zu sein, die Potentiale und Gaben auch im kleinsten Ding und Wesen zu vermuten und mit mehr Tiefenschärfe zu erkennen und anzuerkennen.
Und wie wirkt sich das auf meine seelische Gesundheit aus?
Zum einen sind da die enorm heilsamen Emotionen Dankbarkeit und Wertschätzung oder sogar Liebe, die ich fast wie von alleine immer wieder in mir erwecke wenn ich draußen bin UND sogar während ich mich irgendwo indoor aufhalte.
Wann immer ich beispielweise esse, kann ich diese Dankbarkeit leichter an mich ranlassen, weil ich mir mit der Zeit bewusster werde, wie wunderbar es ist, mich nähren zu können mit den Gaben der Natur an deren Kreation so viele Wesen und Kräfte mitgewirkt haben:
Das reine Trinkwasser, das so kostbar ist und so unendlich wichtig für alles Leben auf der Erde, die Wärme der Sonne, die Leben auf diesem Planeten überhaupt erst möglich macht und letztendlich alle Energie schenkt, die wir als Menschen zur Verfügung haben, über das Wunder der Photosynthese bereitgestellt durch die Pflanzen, gespeichert in der Süße unserer Früchte, in der Stärke des Korns, als Erdöl tief unter der Erde oder im Holz der Bäume.
Nicht selbstverständlich
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr gibt es, wofür ich so dankbar sein kann. Auch der Sauerstoff, den wir mit jedem Atemzug in uns aufnehmen und ohne den wir nicht leben könnten, wird von Pflanzenwesen beständig in die Atmosphäre geschenkt.
Jeder Atemzug bei dem ich Dankbarkeit in mir erwecken kann, wirkt sich enorm kraftvoll auf mein seelisches Wohlbefinden aus – nicht nur in dem Moment selbst, sondern auch mit langfristig potentiell lebensverändernden Effekten für meine seelische und körperliche Gesundheit:
Regelmäßig erlebte Dankbarkeit hilft uns, die uns angeborene, biologisch bedingte Fixierung auf negative Emotionen und potentielle Gefahren zu überwinden, und überhaupt mehr von dem wahrzunehmen zu können, was uns einfach gut tut .
Das bedeutet, dass wir uns langfristig glücklicher fühlen – etwas das noch nicht einmal ein 20 Millionen Lotto-Gewinn für uns zu ermöglichen schafft!
Besser als ein Lotto-Gewinn
Dankbarkeit ist eine Art Allheilmittel: Sie lindert erwiesenermaßen Depressionen und führt dazu, dass wir großherziger werden und andere Menschen uns mehr mögen, unsere eigenen materialistischen Tendenzen schwächer werden, wir uns selbst mehr zutrauen und optimistischer werden, unsere Freundschaften, Familien- und romantischen Beziehungen sich verbessern, wir weniger ungeduldig sind und effektiver Entscheidungen treffen, sich unsere Immunabwehr, unser Schlaf und noch viele weitere, die seelische Gesundheit beeinflussende Faktoren verbessern.
Vieles davon hat damit zu tun, dass das Erleben von Dankbarkeit unser Gehirn regelrecht neuroplastisch umgestaltet, mit Veränderungen die in Studien auch nach Monaten noch im Gehirn messbar waren.
Für mich gibt es zudem noch einen ganz besonders wunderbaren Effekt beim Wertschätzen des gesamten Lebensnetzes, bis hin zu den kleinsten Wesen und Teilchen:
Indirekt finden wir als Menschen dadurch auch einen ganz leichten Zugang dazu, den Wert unserer eigenen, ganz persönlichen Existenz vollständiger wahrzunehmen und zu achten, einschließlich des Wertes all der vielen kleinen (und manchmal ungeliebten oder abgelehnten) inneren Anteile unseres Seins.
Denn in einem Ökosystem, wo alles einen Sinn und Nutzen hat, kann dieser Sinn und Nutzen folgerichtig auch für alles in uns angenommen und vielleicht sogar gefunden oder verstanden werden.

17. Klaren Lebenssinn spüren – ein Teil unserer inneren Natur?
Wenn wir mit der Natur um uns herum in eine tiefe Verbindung gehen, rücken wir der Natur in uns und damit den Fragen nach dem Sinn unseres Lebens sehr nahe.
Indem wir über unsere sinnliche Wahrnehmung intensiv erleben, wie alles mit allem verbunden ist, sich auswirkt, sich beeinflusst und Wandel bringt, können wir ganz deutlich, auf eine körperliche fühlbare Weise, das Prinzip der Gegenseitigkeit begreifen, das allem Leben innewohnt (ausführlich beschrieben vom Biologien und Philosoph Andreas Weber in seinem neuen Buch: Sharing Life, The Ecopolitics of Reciprocity).
Naturverbindung kann uns ermöglichen, zu erahnen oder vielleicht eher uns zu erinnern, was es eigentlich bedeutet, als Mensch auf der Erde zu sein und auf welche Weisen wir Menschen eingebunden sind in das immerwährende Geben und Nehmen dieser Natur, deren Teil wir sind.
Wir bekommen ein klareres Verständnis und Gefühl vor allem dafür, was wir als Menschen unsererseits diesem Lebensnetz zurückschenken können – wir finden und fühlen mehr Sinn in unserem eigenen Dasein.
Lebenssinn ist ein wesentlicher Faktor für menschliches Wohlbefinden. Ihn zu spüren stärkt unsere körperliche und unsere seelische Gesundheit und erleichtert es uns zudem, vor allem in Gemeinschaft mit anderen Menschen, etwas Großes zu leisten!
Die tiefe Freude
Gefühlte Sinnhaftigkeit ist außerdem eine wesentliche Zutat für Eudaimonie – eine Art von Freude oder Glücksgefühl, die nicht an vorübergehende Vergnügungen gekoppelt ist, und nicht nur in den angenehmen, leichten Momenten des Lebens aufkommt. Vielmehr entsteht Eudaimonie wann immer wir uns als Beitragende zu einem größeren Ganzen erleben können, und unser eigenes Tun und Wirken als sinnhaft und nützlich erleben können.
Angesichts all dieser Zusammenhänge ist es nicht überraschend, dass wenn wir uns intensiv mit der Natur verbunden fühlen, uns als sinnvollen, beitragenden Teil dieser Natur erleben können, laut einer Studie von 2019 auch tatsächlich mehr „eudaimonisches Wohlbefinden“ erleben.
Eudaimonie scheint unser Immunsystem besonders zu stärken, was uns unter anderem widerstandsfähiger gegen Stress macht.
Dabei können wir die durch Naturverbindung deutlicher spürbare Sinnhaftigkeit unseres Daseins und die damit verbundene Freude nicht nur dann erleben, wenn wir selbst gerade draußen unterwegs sind und aktiv einen eindeutigen Beitrag zum Wohlergehen andere Wesen schenken (wie beispielsweise einen CO2-speichernden Selbstversorgungsgarten anzulegen, einen Nistkasten für Vögel oder Fledermäuse aufzuhängen oder Pflanzen für Insekten in der Landschaft zu verteilen…), sondern auch bei vielen anderen Gelegenheiten inmitten unseres ganz normalen Alltags, sogar wenn wir indoor unterwegs sind:
Wann immer wir mit unserer Zeit, Energie, Aufmerksamkeit, mit unserem Konsumieren etwas auf den Weg bringen oder unterstützen, das wir als nützlich und hilfreich für das Lebensnetz Erde ansehen, stärkt dies unser Gefühl von Integrität und die Gewissheit, ein sinnvolles Leben zu führen, einen relevanten Beitrag zu leisten.
Sogar indem wir bewusst etwas nicht tun, also auf bestimmte Sachen lieber verzichten, können wir uns als einen relevanten Beitrag schenkend erleben.

18. Natürlich Mitgefühl – Die Verbindung aus Mit-Fühlen und Helfen wollen
Das Element des „Helfen wollen“ ist auch eine Hauptzutat für Mitgefühl. Während Empathie unsere Fähigkeit beschreibt, die Umstände aus den Augen einer anderen Person sehen zu können und ihre Emotionen zu fühlen, steht beim Mitgefühl (engl. „compassion„) ein aktiver Wunsch für das Wohlergehen meines Gegenübers im Zentrum.
Mitgefühl scheint tatsächlich eine der wirkkräftigen menschlichen Haltungen zu sein, insbesondere im Buddhismus (aber auch anderen Glaubenssystemen) seit Jahrtausenden kultiviert und in den letzten Jahren durch unzählige Studien von wissenschaftlichen Instituten in aller Welt erforscht. Die Universität in Stanford Kalifornien hat sogar ein eigenes Zentrum für „Mitgefühl & Altruismus„, auf dessen Webseite sie schreiben, dass Mitgefühl „eine der stärksten Triebkräfte der Menschheit für Veränderung“ sei.
Mitgefühl könnte lebens-wichtig sein
Auch der Dalai Lama sagt: „Liebe und Mitgefühl sind kein Luxus, sondern Notwendigkeiten. Ohne sie wird die Menschheit nicht überleben.„
Dabei hilft unser Mitgefühl nicht nur unserem Gegenüber, sondern auch uns selbst: Mitgefühls-Übungen führten in einer Studie messbar dazu, dass die Konfrontation mit dem Leid anderer messbar im Gehirn nicht nur die für unangenehme Emotionen bekannten Regionen aktivierte, sondern zusätzlich auch Regionen aktiv wurden, die mit angenehmen Emotionen verbunden sind – es verringerte sich also das eigene „Mit-Leiden“ angesichts der Not von anderen. Somit könnte es leichter werden, dass wir uns nicht davon überwältigt fühlen.
Dieser Zusammenhang könnte eine Erklärung dafür sein, dass Mitgefühl gerade für Menschen in helfenden Berufen essentiell dafür ist, nicht emotional auszubrennen. davor schützt, auch über lange Zeiträume nicht emotional auszubrennen. Vielmehr scheint es so, dass wir durch Mitgefühl auch angesichts großer Not leichter für andere da sein können, und uns dabei sogar weniger selbst zu erschöpfen – eine Kompetenz die angesichts globalen Leids weiterhin sehr wichtig für unsere seelische Gesundheit sein wird.
Mitfühlen mit denen, die ganz anders sind
In Studien wurde gezeigt, dass Empathie, also das Nachfühlen oder Mit-Fühlen mit einem Gegenüber nicht nur unbewusst abläuft, sondern wir es bewusst steuern können, unter anderem indem wir uns in die Situation des anderen hinein versetzen. In einer wissenschaftlichen Veröffentlichung hierzu heißt es: „die Regulation der eigenen egozentrischen Sichtweise ist eine Grundvoraussetzung dafür, andere verstehen zu können„.
Wenn wir uns bewusst mit unseren nicht-menschlichen Mitwesen verbinden, üben wir beständig, unsere egozentrische Sichtweise ein Stück weit hintenanzustellen und uns in „die anderen“ hineinzuversetzen – mit Hilfe von Wissen und eigenen Beobachtungen, aber auch durch bewusstes Einfühlen und immer wieder Variationen der Frage: „Wie ist es, du zu sein?“.
Ich habe diese einfache Frage erstmals 2019 während einer Veranstaltung von Charles Eisenstein gehört, und sie bündelt viel von dem, worauf Naturverbindungpraxis hinaus läuft: Wir Menschen, die wir von Grund auf zutiefst soziale Wesen sind, nutzen unsere natürlichen Fähigkeiten dafür, uns nicht nur in unsere Liebsten, vertrautesten Menschen in unserem Leben einzufühlen, sondern in die allerunterschiedlichsten Wesen.
Indem wir unser Mitgefühl ausdehnen auf hungrige Bienen in unserm Garten, Weinbergschnecken beim Überqueren einer Straße, die Stadtbäume vor unserm Haus und die Krähen in ihren Kronen, können wir auf allereinfachste Art einen Unterschied für die Erde machen und kreieren gleichzeitig mehr Gelegenheiten für uns selbst, etwas zu Üben, was unsere eigenen körperlichen Stressreaktionen verringern könnte:
In einer finnischen Langzeit-Studie wurde über einen Zeitraum von 15 Jahren untersucht, welchen Einfluss Mitgefühl zum einen auf die Empfindlichkeit für Stress und zum anderen auf die körperlichen Folgen von chronischem Stress hatte. Das Ergebnis der Studie deutet darauf hin, dass ausgeprägtes Mitgefühl Menschen vor den Auswirkungen von Stress schützen könnte. (Und auch, dass selbst angesichts von großem Stress unsere Kapazität für Mitgefühl scheinbar nicht beeinträchtigt wird).

19. Selbstmitgefühl leichter machen durch die Verbindung zu unseren Mitwesen
Unzählige wissenschaftliche Studien der letzten Jahre beschäftigen sich mit einer Kern-Kompetenz für Resilienz und seelische Gesundheit, die viele Menschen weltweit, vermutlich insbesondere in den westlichen, konsum- und leistungsorientierten Ländern erst langsam schätzen und nutzen lernen: das Selbstmitgefühl. (Hier kannst du mehr über Selbstmitgefühl lernen und erfahren.)
Auch wenn Selbstmitgefühl nicht automatisch durch Naturverbindungs-Praxis entsteht, glaube ich dass sie uns doch dabei unterstützen kann.
Eine Hürde zum Selbstmitgefühl sehe ich darin, die vielen Anteilen und Stimmen in uns, die wir als unangenehm, als zu schwach oder zu stark, zu hässlich oder zu schön, zu laut oder zu leise oder in irgendeiner anderen Art als „komisch“ und nicht liebenswert wahrnehmen – trotzdem als menschlich anzunehmen, sie in uns willkommen zu heißen, nicht mehr vor uns selbst und vor der Welt verstecken zu wollen. Erst wenn wir es schaffen, sie überhaupt wahrzunehmen, können wir beginnen, ihnen mit Mitgefühl zu begegnen.
Imperfekt vollkommen – so wie wir
In unserer Mitwelt draußen können wir tagtäglich unzählige Formen des Lebens entdecken und beobachten, die keinem Schönheits- oder Erfolgsideal entsprechen. Wir erleben an einem Nachmittag im Park oder Wald eben nicht nur majestätische Tiger die sich vor fast gar nichts fürchten und formvollendete Blüten die wie von Meisterhand gemalt erscheinen – sondern jede Menge Leben im Zustand des „erst Werdens“ oder „schon fast wieder Vergehens“ – welke Blätter, Spinnen mit fehlenden Beinen, nur für sehr wenige Menschen als „schön“ erkennbare Häufchen von Losung und eine endlose Zahl kleinster Lebewesen, deren Besonderheiten sich nur bei ganz naher, geduldiger Betrachtung zeigen.
Und doch wird im Betrachten deutlich, dass alles für irgendjemanden nützlich oder sogar wichtig ist. Ich glaube, dass wir draußen beständig in bunten Farben (und jeder Menge grau, braun und grün) vorgelebt bekommen, wie wirklich alles dazu gehört zum Netz des Lebens. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Vertrautheit mit allen Facetten des Lebensnetzes außen (und vor allem auch unsere mitfühlende Haltung den unzähligen dazu gehörenden Wesen gegenüber), es uns viel viel leichter macht, die vielen Facetten unseres Innenlebens ebenfalls mit Mitgefühl annehmen zu können.

20. Gelegenheit zum Geben für Natur
Je emotionaler unsere Verbindung zur Natur ist, desto leichter wird die darin wohnende liebe-volle Kraft es uns auch machen können, noch einen Schritt weiter zu gehen und berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeiten zu ergreifen, die direkt oder indirekt einen Beitrag zur Erhaltung von Naturräumen, Artenvielfalt oder Fruchtbarkeit der Landschaft leisten kann.
Wie wissenschaftliche Studien mehrfach gezeigt haben, ist Naturverbindung wirklich einer der wesentlichen beeinflussenden Faktoren für handfestes „Umwelthandeln“, also ein umweltschützendes Verhalten.
Das ist für die Welt gut – aber auch für uns selbst?
Tatsächlich hat die Wissenschaft inzwischen ganz klar beschrieben, wie positiv es sich auf unser persönliches Wohlergehen auswirkt, wenn wir etwas verschenken oder für andere tun.
Verschenken bereitet uns sogar mehr Freude, als wenn wir uns selbst etwas Neues kaufen. Dabei geht es nicht einmal primär um das Feedback von Freude durch die von uns Beschenkten, sondern vor allem darum, wie sehr wir selbst davon ausgehen, dass wir jemandem etwas Gutes getan haben.
Stress mildern
Eine Studie in Michigan untersuchte 800 Menschen über einen Zeitraum von einem Jahr. Während allgemein ein höheres Stress-Level zu höherer Sterblichkeit führt, traf dies nicht auf Menschen zu, die anderen halfen. Bei Menschen, die anderen halfen, führte Stress nicht zu einer höheren Sterblichkeit. Für andere da zu sein, scheint uns also dabei zu helfen, so mit Stress umzugehen, dass er unsere Gesundheit weniger beeinträchtigt.
Ich vermute, dass dieser tolle Effekt ganz sicher auch funktioniert, wenn wir etwas für unsere nicht-menschliche Mitwelt tun:
Eine Vogelfutter-Station aufhängen, einen Garten hegen, sogar wenn wir einfach nur für unsere Mitwesen da sind, ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken, ihnen zuhören, uns mitfühlend einfühlen, während wir an der Bushaltestelle warten oder auf dem Weg zur Arbeit – alles was wir bewusst und aus dem Wunsch heraus tun, die Existenz der anderen etwas besser zu machen, kann für uns selbst ein kleiner Beitrag sein.
Auch Geld spenden könnt eine Möglichkeit sein, einen Beitrag zu schenken – auch an Initiativen wie die Gesellschaft für bedrohte Völker. (Denn wie aus einem Bericht der UN hervorgeht machen indigene Kulturen zwar nur noch 5% der Weltbevölkerung aus, ihre regenerativen, über Jahrtausende erprobten Landbewirtschaftungsweisen sind jedoch verantwortlich für 80% der weltweit noch vorhandenen Artenvielfalt – dabei sind viele von ihnen bedroht von Landraub aufgrund der Interessen großer Konzerne.)
Und nicht zuletzt kann auch das öffentliche sichtbar machen unserer Sorge für die Erde ein gewichtiger (und für großen Wandel vielleicht sogar notwendiger) Beitrag sein, mit dem wir politische Entscheidungen beeinflussen können, vor allem wenn wir unsere Anstrengungen zusammen mit anderen bündeln, zum Beispiel über die Fridays for Future Bewegung, die inzwischen in zahlreichen Städten weltweit Aktionsgruppen hat.

21. In der Natur Schönheit finden kann freundlicher machen
In Studien der Universität Berkeley wurde festgestellt, dass die prosozialen Auswirkungen von Natur besonders stark waren, je mehr Schönheit die Teilnehmenden in der Natur sahen: Landschaften oder auch Pflanzen die als besonders schön eingestuft wurden bewirkten, dass die Menschen sich anschließend hilfsbereiter, großzügiger und vertrauensvoller verhielten.
Doch ob und in welchem Maße wir Schönheit wahrnehmen ist individuell verschieden: In anderen Studien zeigte sich, dass es manchen Menschen tendenziell viel leichter fiel als anderen, Schönheit wahrzunehmen – und diese Schönheitsliebenden dann auch weniger materialistisch, oft grundlegend dankbarer eingestellt waren, und sich anderen Gegenüber prosozialer verhielten.
Doch was könnte den Unterschied dafür machen, ob wir selbst empfänglicher für die Schönheit um uns herum sind?
Meine Vermutung ist zum einen, dass das ästhetische Empfinden sich umso mehr Entfalten kann, wenn wir Resonanz von vertrauten Personen spüren, die sich mit uns gemeinsam an der Schönheit erfreuen und durch die Spiegelung sich angenehme Gefühle noch verstärken können – so wie in der Redensart, wo aus geteilter Freude doppelte Freude werden kann.
Außerdem ist es möglich gezielt Ausschau nach Schönem zu halten, und das ist Übungssache: Selbst in einer grauen Wohngegend finden wir dann vielleicht die eine strahlend gelbe und fast symmetrische Löwenzahnblüte.
„Schönheit liegt im Auge des Betrachters“ sagt man, und so können wir auch im Körper und den zarten Flügeln einer Stechmücke noch Schönheit erkennen – wenn wir es schaffen, auf die „richtige“ Art und Weise hinzuschauen.

22. Aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft allen Lebens
Wie wir hinschauen (und hören, spüren und fühlen), und dadurch die Welt um uns herum und unsere Mit-Wesen wahrnehmen, entscheidet auch darüber, wie sehr wir uns allein fühlen, wenn gerade keine anderen Menschen da sind.
Zustände von Einsamkeit breiten sich in der zivilisierten Welt aus wie eine Epidemie, vor allem junge Erwachsene, ältere Menschen, zunehmend auch Kinder und Jugendliche fühlen sich schrecklich einsam und allein.
Für das Erleben von Einsamkeit ist dabei nicht entscheidend, wie sehr wir sozial eingebunden sind, mit wie vielen Menschen wir tagtäglich zu tun haben, sondern der Begriff beschreibt das subjektive, sehr schmerzliche Erleben, dass die eigenen sozialen Bedürfnisse durch die Anzahl und Qualität der bestehenden Beziehungen nicht gestillt werden können.
Dabei kann Einsamkeit ein deutlicher Vorbote von körperlichem Schmerz, Depressionen und Erschöpfungszuständen sein und das Erleben von Einsamkeit kann die Lebenszeit drastisch verkürzen, unter anderem durch Herzerkrankungen, die viel häufiger Menschen treffen, die sich oft als einsam erleben.
Einsamkeit konnte in Studien auch mit der Entstehung von Persönlichkeitsstörungen, Psychosen, Selbstmord, einem Verkümmern kognitiver Fähigkeiten im Alter und Alzheimer in Verbindung gebracht werden.
In einer ab 1938, also über 80 Jahre laufenden Langzeitstudie in den USA wurde erforscht, welche Faktoren Gesundheit und Wohlbefinden beeinflussen und welcher davon wohl der Wichtigste sein könnte. Zu Beginn dieser Studie wäre niemand darauf gekommen, was das ganz deutliche und für viele Menschen aufrüttelnde Ergebnis sein würde. Einer der Forschenden, George Vaillant, formulierte es so: „Als die Studie begann interessierte sich niemand für Empathie oder Bindung. Aber der Schlüssel für ein gesundes Altern sind Beziehungen, Beziehungen, Beziehungen.“
Beziehungen als Schlüssel
Sein Kollege Robert Waldinger spitzt es noch mehr zu: „Einsamkeit tötet“ – weil das Erleben von Einsamkeit die Lebenserwartung so deutlich herabsetze.
In Versuchen wo Menschen durch Hypnose kurzzeitig in Einsamkeits-Zustände versetzt wurden, erlebten diese gesteigertes Stress-Empfinden, Angstzustände, Furcht vor negativer Bewertung, Wut und verringerten Optimismus und Selbstwertgefühl. In einem Artikel dazu heißt es: „Unser soziales Eingebundensein ist wie ein Gerüst für unser Selbst – wird das Gerüst beschädigt, leidet auch unsere Vorstellung von uns selbst darunter.„
Auch unsere Beziehungsfähigkeit leidet: Menschen die gerade Einsamkeit erleben waren in einer Studie sogar weniger in der Lage, die beziehungsstärkenden Signale von Partner*innen überhaupt noch wahrzunehmen, selbst wenn diese sehr viel Energie in ihre Botschaften steckten.
Einige Studien der letzten Jahre haben gezeigt, dass es Menschen, die sich einsam fühlen, umso leichter fallen könne, sich mit der Natur in ihrer Gesamtheit verbunden zu fühlen, oder auch die Verbindung zu der (für viele Menschen eher abstrakten Idee) der gesamten Menschheit zu fühlen.
Der Neurowissenschaftler John Cacioppo beschreibt, woran dies liegen könnte: „Einsamkeit ist ein Mechanismus, der unsere Existenz als Menschen unterstützt. Wir können durch sie feststellen, wenn unsere Verbindung mit anderen, für gegenseitige Unterstützung und Schutz gefährdet oder abwesend sind – denn das könnte tötliche Folgen für uns haben.“

Unser inneres Beziehungs-Schutz-System
Das kurzzeitige Erleben von Einsamkeit ist also Teil unserer natürlichen Ausstattung, denn sie kann uns dazu bewegen, unser Beziehungsleben immer wieder bewusst zu nähren und zu stärken.
Gleichzeitig stresst selbst kurze Einsamkeit uns so sehr, dass wir uns erstmal weniger sozial verhalten: „Wenn du dich einsam fühlst, gehst du in Verteidigungshaltung. Unbemerkt für dein bewusstes Denken fokussiert sich dein Gehirn mehr auf den Schutz von dir selbst als auf die Erhaltung der Menschen um dich herum, was dazu führen kann, dass es für andere weniger angenehm ist, mit dir zusammen zu sein.“
Dieser Effekt kann mit der Zeit zu immer mehr Vereinsamung führen.
Wenn Einsamkeit chronisch wird, also über längere Zeiträume erlebt wird, wirkt sie besonders zerstörerisch, und das Gefühl von Einsamkeit kann sich mit der Zeit immer mehr steigern.
In den Jahren als Sobonfu Somé noch lebte sprach sie oft davon, für wie absolut lebensnotwendig Gemeinschaft in ihrem Heimatdorf in Westafrika angesehen wird. Gemeinschaft sei DER Raum in dem andere unsere Gaben empfangen, ein Grundbedürfnis aller Menschen – wenn uns Gemeinschaft fehlt, könnten wir vor Einsamkeit regelrecht verrückt werden.
Cacioppo sagt: „Die wahrgenommene Einsamkeit verstärkt sich, wenn wir niemanden haben, die für uns da sind, oder für die wir da sind. Als Kinder sind wir abhängig von Erwachsenen. Wenn wir selbst erwachsen werden, glauben wir es ginge darum, unabhängig zu werden – König auf unserem eigenen Berg. Aber bei allen sozialen Säugetieren – nicht nur bei uns Menschen – geht es beim erwachsen werden eigentlich vielmehr darum, jetzt selbst zu diesen Personen zu werden, die für andere da sind.“
Wer gehört zu meinem Beziehungsnetz?
Eine Frage, die sich daraus ergibt um Wege aus der Einsamkeit zu finden könnte also sein: Wer sind die Wesen, für die ich da bin?
Und: Wer sind die Wesen, die für mich da sind?
Mit dieser Frage rauszugehen kann unglaublich berührende Erlebnisse ermöglichen: In den letzten Jahren konnte ich immer wieder Geschichten von Menschen hören, die Bäume, einen Bach, Vögel, Insekten, selbst kleine Pflanzen oder Steine, den Wind, Regen, die Sonne oder andere Sterne für wenige Momente, oft aber immer wieder als präsente, liebevolle, verlässliche Älteste oder Freunde erlebten.
Unsere Mit-Wesen draußen, und sogar auch die kleinsten Tiere, die uns manchmal bis ins Haus besuchen, ja selbst unsere Zimmerpflanzen können Menschen erleben als Personen, die in seelischen Not-Situationen „einfach für mich da waren.„

23. Natur validiert UND erweitert unsere Sichtweise
Wenn wir draußen unterwegs sind verstehen wir unsere Mitwesen nicht nur über ihre Präsenz mit uns, sondern auch über ihre Symboliken. In einer psychiatrischen Klinik war ein Ergebnis eines Garten-Projektes, dass die beteiligten Patient*innen die Erfahrungen draußen nutzten, um anhand der von ihnen selbst entdeckten Symboliken über ihre eigenen Leidensweg zu reflektieren und daraus neue Erkenntnisse für sich zu sammeln.
Wenn wir mit Naturverbindungs-Praxis draußen unterwegs sind, also in Kontakt und Verbindung gehen wollen, entdecken wir nach meiner Erfahrung nach oft spontan etwas, das unserem inneren Erleben sehr nahe kommt, ein anderes lebendes Wesen, dass ähnliches durchzumachen scheint.
Meine Vermutung ist, dass diese Begegnungen uns die so wichtige Erfahrung ermöglichen können, mit unseren Gefühlen und Emotionen validiert zu werden.
Validieren ist ein Fachbegriff für das Bestätigen oder Bekräftigen der Gefühle meines Gegenübers. In vielen Kommunikations-Schulen ist es ein wesentlicher Schritt um dem anderen zu helfen, sich überhaupt erstmal gehört und verstanden zu fühlen (als Grundvoraussetzung für eine spätere Einigung).
Eine vielfach erlebte Symbolik, aus der viele Menschen Trost und Zuversicht ziehen, ist das Entdecken von „alten, vernarbten Wunden“ im Stamm von Bäumen. Der Zusammenhang zwischen einer früheren Verletzung und der Narbe die daraus erwachsen ist, die den Baum „so viel interessanter“ oder „schöner“ macht, inspiriert Menschen immer wieder dazu, ihre eigenen, oft seelischen Narben liebevoll annehmend oder sogar wertschätzend zu betrachten.
Wir können also im Idealfall eine Verbindung aus Validieren sowie einer Erweiterung unserer eigenen Perspektive erleben. Vielleicht könnte unsere Naturbegegnung es uns auf diese Weise möglich machen, schöpferischer mit einer Situation umzugehen und lebensfreundlichere Entscheidungen zu treffen.

24. Bedeutung verleihen als menschliches Grundbedürfnis
Menschen scheinen es zu lieben, Muster zu erkennen. Viele von uns suchen (auch unbewusst) nach Bedeutung in allem was uns umgibt: Wolkenbilder, das für uns so normale Lesen von Buchstaben, die Wörter und ganze Texte ergeben, Charakteristika in unseren Namen, Gesichter die für uns in der Maserung von Holzbrettern oder in Alltagsgegenständen auftauchen, auch das Herleiten von Persönlichkeitstypen anhand von Geburtsdatum und -Ort, Orakeln mit Bleigießen in der Silvesternacht und so vieles mehr können wir entdecken oder erfinden, mit dem wir unser Bedürfnis nach Bedeutung stillen können.
Gerade im Bereich der Trauma-Therapie ist seit langem bekannt, dass unsere Fähigkeit, auch den schlimmsten Geschehnissen eine lebensförderliche Bedeutung zu verleihen einen wesentlichen Unterschied dafür macht, wie gut wir Schicksalsschläge überstehen und trotz ihrer Schrecklichkeit wieder zu Lebensfreude finden können.
Wichtig ist meines Erachtens dabei, dass Bedeutung und Sinn nicht einfach nur „gefunden“ werden können, als ob sie schon von Vornherein existieren würden. Wenn ein Kind vernachlässigt oder missbraucht wird, hat dieses tragische Geschehen in sich keinen Sinn, es ist im Gegenteil zutiefst sinn-los.
Es liegt bei uns selbst
Nur die betroffenen Personen selbst können eines Tages als Teil von ihrem Selbstheilungsprozess wählen und entscheiden, welche Bedeutung, welchen Sinn sie dem Geschehenen geben wollen – eine Wahl die, so beschreibt die Trauma-Forscherin Judith Herrmann es in ihrem Buch, viel Energie für den weiteren Lebensweg freisetzen kann.
Auch unseren kleinen Schicksalsschlägen und Herausforderungen, wie auch den angenehmen Überraschungen des Lebens können wir Bedeutung geben (und tun dies oft unbewusst).
Hier kann unsere Verbindung zur Natur helfen, uns eine Vielzahl von symbolischen Möglichkeiten zur Auswahl zu zeigen – ohne uns eine bestimmte davon aufzudrängen.
Als Mutter eines Teenagers kann ich selbst wählen, ob ich mich mit den Vogeleltern identifiziere, die jetzt im Herbst so viel unbeschwerter zu sein scheinen, wenn endlich die Jungen aus dem Nest sind – oder mit den Wölfen, deren Jungtiere viel langsamer zu lernen scheinen, was man so zum Leben braucht, und oft noch recht weit bis ins Erwachsenenalter hinein mit den Eltern rumhängen.
Ich kann auf beide Bilder (und auf noch viele andere) zugreifen, um wann immer ich Bedarf habe, für mich passende, hilfreiche Bedeutungen zu finden – und auch mehrere davon nebeneinander zu stellen, wenn es dienlich oder gebraucht erscheint.
Unkonventionelle Bilder
Bilder aus der Natur sind zudem Eindrücke und Erfahrungen aus einer Daseins-Welt, wo Konsum, Trends und Mode keine Rolle spielen – wir also dem erdrückenden Raster von teilweise sogar gegensätzlichen Ansprüchen, welches unser tägliches Leben gerade im Internet-Zeitalter fest umklammert hält, ein Stück weit entkommen können.
Und dank der mannigfaltigen Vielgestalt und Wandelbarkeit von Bildern aus der natürlichen Welt, weiß ein Teil in mir ganz genau, dass welche auch immer ich mir wähle, auch immer nur Symbole sind. Ich vermute, dass es Menschen deshalb leichter fallen könnte, selbst gewählte Bilder aus der Natur bei Bedarf durch andere zu ersetzen – anstatt auf dogmatische Weise an ihnen festzuhalten.
Denn eine der wichtigsten Fragen fürs Bedeutung verleihen ist meines Erachtens nach nicht nur: „Welche Bedeutung wäre für mich persönlich die hilfreichste oder angenehmste?“ sondern vor allem:
„Welche Bedeutung könnte für mich selbst UND die anderen hilfreich sein (also für Menschen und andere Wesen, die von meinem Denken und Handeln betroffen sind, ebenso wie das größere Ganze)?„
Für ebenso wichtig halte ich es, einmal gefasste Antworten immer (mal) wieder zu hinterfragen und zu überprüfen, ob sie immer noch stimmig sind, immer noch hilfreich für mich selbst und die anderen? Oder ob es ansteht, sie zu erweitern oder meine Suche nach Bedeutung zu vertiefen oder ganz neu auszurichten?

25. Natur als Mentorin
Wenn wir uns mit einer Gruppe von Menschen aufmachen, zu erforschen, was es heißt, andere auf deren Lern- und Lebensweg zu begleiten, sind eine wichtige Einladung und Frage ganz am Anfang dieses Prozess: „Welche Wesen findest du draußen in der Natur, die für dich selbst Mentor*innen sein könnten?“
Wir wissen nicht, ob die vielen berührenden und manchmal auch humorvollen Erlebnisse, die durch das Erforschen dieser Aufgabe möglich werden, einfach ein Widerhall der eigenen inneren Mentor*innen-Weisheit sind – oder ob Bäume, Steine, Vögel, Erde oder Himmel tatsächlich auf einer Ebene wirklich für uns als Menschen da sind.
Unsere Erfahrung zeigt jedenfalls, dass unsere Wahrnehmung der Natur und ihrer Bedeutungsebenen mit unserem eigenen seelischen Reifungsprozess nicht nur passgenau mitzuwachsen, sondern oft einen Schritt voraus zu sein scheint – im Beziehungsraum zwischen ihr und uns wohnt etwas, was als nächstes passieren könnte.
Denn Natur lockt uns: Mit Gelegenheiten zum Klettern, zum Sammeln, zum Jagen (was meistens wohl eher ein etwas Einfangen ist), zum Entdecken, Abtauchen und – für viele Erwachsene besonders relevant – zum einfach durch sie hindurch Laufen.
Impulsen folgen
Inmitten der Natur wählen wir uns einen Weg (oder ein Ziel), welche unseren Vorlieben entsprechen, und unsere Mitwesen sind mit dabei. Wenn wir sie wahrnehmen und ernst nehmen, können wir das Gefühl erleben, auch von ihnen bezeugt zu werden, und je mehr wir selbst darin geübt sind, vieles wahrzunehmen, desto bunter und vielgestaltiger kann das Bild werden, in dessen Mitte wir uns wiederfinden:
Indem wir beispielsweise das Alarmsystem der Natur verstehen lernen: Wenn wir wissen wie die Amsel reagiert, wenn wir gestresst an ihr vorbei hasten (oder achtsam gehen), wird es uns möglich auch unsere eigenen Auswirkungen auf sie (und alle anderen) zu erkennen und bewusst(er) zu gestalten.
Indem wir den Fährten des Fuchses durch den Schnee folgen lernen, können wir vielleicht irgendwann erkennen wie er auch unsere Fußspuren wahrnimmt und sich auf eine bestimmte Weise dazu verhält.
Wenn wir mit unsern Mitwesen in Verbindung sein wollen und dem aktiv nachgehen, können wir beständig und lebenslang daran wachsen und reifen – wir können in ihrer Mitte die Heldenrolle in unserer eigenen Lebensgeschichte spielen und dabei doch immer wieder deutlich wahrnehmen, dass wir nur ein winziger Faden in einem riesig großen und überwältigend schönen Netz sind, das alle lebenden Wesen umspannt.

26. Im Kreis der natürlichen Zyklen
Es kann tröstlich und erhebend zugleich sein, natürliche Rhythmen, Muster und Kreisläufe zu erforschen, und sehr inspirierend dazu.
Wir kennen die meisten von ihnen bereits aus unserem inneren Erleben. Wir haben in uns ein Herz und eine Lunge, die sich rhythmisch zusammenziehen und wieder ausdehnen, spürbar über unseren Puls und unseren Atem, so sind wir vertraut mit Wellenbewegung in all ihren Erscheinungsformen.
Die Drehungen um die Erdachse schenken uns nicht nur Tag und Nacht, sondern ganz unterschiedliche Tages-Phasen, den zarten aber kraftvollen Sonnenaufgang, der nach dem Dunkel der Nacht das Licht zurück bringt, einen Vormittag mit zunehmender Helligkeit und Wärme schenkt, die ihren Höhepunkt am frühen Nachmittag findet, kurz bevor das Licht die Welt golden aufleuchten lässt, wenn der Sonnenball hinter den Horizont sinkt, und wir nach und nach immer mehr Sterne am schwarz werdenden Nachthimmel erkennen können.
Die Wanderung unseres Planeten um die Sonne schenkt uns die Jahreszeiten, vier davon in unserem Teil der Erde, und Übergangszeiten zwischen ihnen. Je mehr wir verbunden sind mit dem Rhythmus, den Erscheinungen von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, desto leichter können wir ihre Qualitäten und Eigenheiten auch in uns selbst erkennen und mit ihnen schöpferisch umgehen lernen.
Ein Teil des großen Ganzen
Auch die Verbindung zu den Rhythmen der Natur kann uns ermöglichen, den größeren Kontext zu erfassen, nicht nur auf die Wahrnehmung unseres kleinen Selbst beschränkt zu sein, sondern mit Ehrfurcht zu erkennen, wie sehr unser inneres Erleben nicht nur dem Ablauf des großen Ganzen entspricht, sondern sogar ein Teil davon ist, als würden wir ein Instrument spielen inmitten eines gigantischen Symphonie-Orchesters.
Jahreszeitliche Veränderungen wurden und werden in vielen Teilen der Erde gefeiert, und meine Vermutung ist, dass dies nicht nur dabei hilft, das zu würdigen, was die Natur für unsere menschlichen Bedürfnisse bereit stellt (nämlich im Grund alles was wir brauchen und gebrauchen!).
Ich glaube, dass das Feiern dessen was um uns herum geschieht es außerdem so viel leichter macht, die Dynamik in unserem Inneren zu erkennen, zu verstehen und auf lebensförderliche Weisen mit ihr umzugehen.
Wandel miterleben
Wir können ein Jahr lang immer wieder eine Linde besuchen, im Frühling von ihren zart-grünen Blättern naschen, im Frühsommer den Duft ihrer Blüten schnuppern, umsummt von Bienen und anderen Insekten ein paar davon für Tee einsammeln, später den Sommer-Wind die zarten Samen fortblasen sehen, die Knospen fürs neue Jahr entdecken (lange bevor im Herbst die Blätter abfallen), später miterleben, wie das Laub immer weiter aufgeknabbert und zerlöchert wird, bis der Rest sich endlich im Herbst goldgelb färbt und hinuntersegelt, wovon das meiste am Boden schnell zersetzt wird… und dann monatelang warten und warten und warten, wie die Linde die Kälte und Dunkelheit überdauert, bis irgendwann im Vorfrühling ganz allmählich die Knospen beginnen zu schwellen, als Vorboten für das neue Grün des neuen Jahres.
Ich glaube solch ein bewusstes Mit-Erleben kann helfen, sogar inmitten einer auf Leistung, Erfolg und Produktivität orientierten Gesellschaft ein Gefühl von Frieden und sogar Freude am eigenen Winter zu finden – der auch mindestens einmal im Jahr kommt und uns zu Ruhe und Abwarten im Außen einlädt, bis Sonne und Wärme zurückkehren. Und dabei inmitten dieser stillen Zeit vielleicht einen tieferen Zugang zu uns selbst zu finden, um unsere innere Ausrichtung zu erneuern und auf diese Weise Kraft fürs neue Jahr zu tanken.

27. Endlichkeit & beständiges Entstehen neuen Lebens
Wir alle werden eines Tages sterben und die Mehrheit der Menschen scheint diese Tatsache im Alltag weitgehend auszublenden. Hunderte von Studien haben sich in den letzten Jahrzehnten damit beschäftigt was passiert, wenn das Bewusstsein eines nahenden Todes uns doch erreicht, Menschen sich also vorstellen, sie würden bald sterben.
Viele der frühen Ergebnisse deuteten daraufhin, dass Todesnähe vor allem Angst in Menschen schürt: nationalistische und rassistische Vorurteile und Urteile über andere religiöse Gruppen oder Altersgruppen würden verstärkt, wir identifizierten uns stärker mit unserer jeweiligen In-Group, verteidigten unsere eigenen Standpunkte vehementer und egal welcher politischen Strömung wir angehörten, würden wir wir uns leichter konservativen Strömungen und Personen zuwenden. Menschen die in einer Studie die Möglichkeit hatten jemand anders zu bestrafen, wählten eine durchschnittlich fast zehnmal so hohe Strafe (es ging um einen Geldbetrag) wie die Kontrollgruppe, die nicht mit dem eigenen Sterben konfrontiert war.
Die diesen Studien zugrunde liegende „Terrormanagement Theorie“ geht davon aus, dass ein Großteil des menschlichen Verhaltens darauf zurückzuführen ist, dass wir uns dem Tod auf keinen Fall stellen wollen.
Gleichzeitig betont einer der Begründer der Theorie, Sheldon Solomon, dass wir sogar Frieden und Mitgefühl fördern können, wenn wir den uns und unseren Liebsten bevorstehenden Tod eben nicht ausblenden, sondern vielmehr anerkennen.
Uns alle erwartet der Tod
Als Menschheit säßen wir alle im selben Boot – einem „sinkenden Boot“ wie er sagt. Uns daran zu erinnern könne unseren Sinn für Gleichwürdigkeit und Gemeinsamkeit stärken.
Viele jüngere Studien haben deutlich positive Auswirkungen einer Konfrontation mit dem nahenden Tod feststellen können, beispielsweise, dass in uns das Bedürfnis stärkt, ein Erbe zu hinterlassen, was mit mehr Motivation gesund zu leben und auch mit dem Wunsch nach spirituellem Wachstum einhergeht.
In anderen Studien wurde beschrieben, dass Menschen sich stärker ihren positiven Werten entsprechend verhalten, ihren Fokus auf den Aufbau unterstützender Beziehungen setzen, sich für die Entwicklung friedvoller, gemeinnütziger Gemeinschaftsprojekte einsetzen und insgesamt offene und auf Entwicklung ausgerichtete Verhaltensweisen praktizieren.
Forschende an der Universität in Amsterdam kamen zu dem Schluss, dass wir angesichts des Todes unser Bedürfnis nach Eingebundensein in eine Gemeinschaft so stark würde, dass Menschen sogar bereit wäre, vorgefasste Meinungen und Weltsicht unterzuordnen, um dazugehören zu können.
Die Vorstellung vom eigenen Tod kann außerdem ein kraftvoller Auslöser für intensive Dankbarkeit sein, sogar für Menschen denen es gerade (oder allgemein) schwer fällt, Dankbarkeit zu empfinden.
Der Psychologe Steve Taylor interviewte für ein Buch eine Reihe von Menschen, denen der Tod in Form von Krankheit oder Unfällen nah gekommen ist.
Sie beschrieben eine „transformative Wirkung“ und sprachen ebenfalls von enormer Dankbarkeit, auch von einer veränderten Wahrnehmung der Welt als „echter“, „lebendiger„, „voller Schönheit„.
Sorgen und Ängste die sie vorher bedrückten seien wie verschwunden gewesen, beispielsweise ob andere Menschen sie mögen könnten oder nicht, dass sie beruflich scheitern könnten, oder Sorgen über Erlebnisse in der Vergangenheit, die jetzt einfach nicht mehr wichtig erschienen.
Was uns wirklich wichtig ist
Taylor fasst es als Wandlung auf, weg von egozentrischen und materialistischen Einstellungen, hin zu einer weniger selbstsüchtigen, mehr altruistischen Haltung, verbunden mit einem Loslassen – von Ängsten, Ehrgeiz, Konzepten oder Status.
Er zitiert den Rockmusiker Wilko Johnson, der einige Monate zuvor eine Krebsdiagnose bekam und im Interview mit der BBC erzählte:
„Wir verließen den Raum und ich fühlte wie sich meine Stimmung hob. Du läufst einfach und fühlst dich plötzlich so unbändig lebendig. Du siehst die Bäume und den Himmel und alles und es ist einfach whoah! Ich hab den Großteil meines Lebens in Depressionen versunken zugebracht, aber das ist alles weg.… Sachen die mich runtergezogen haben oder mich besorgt oder genervt haben, die machen mir nichts mehr aus – und dann fragst du dich: Wow, warum hab ich das nicht vorher verstanden? Warum hab ich nicht früher kapiert, dass es nur jeder einzelne Moment jetzt ist, der wirklich wichtig ist?„
Die wesentliche Frage die sich stellt ist, wie ein Bewusstsein für den Tod so viel negative Auswirkungen in manchen Situationen haben kann und in anderen das Gegenteil zu bewirken vermag?
Und natürlich: Was das alles mit Naturverbindung zu tun hat? :-)
Taylor erklärt, dass die Intensität unserer Begegnung mit der Sterblichkeit eine Rolle spielen könnte.
Ängste würden vorherrschen, solange wir auf passive und vage Weise an den Tod dächten, statt uns ihm gefühlsmäßig zu stellen.
Er schreibt: „Wenn wir uns dem Tod aktiv und unmittelbar stellen, dann haben wir die Chance unsere Ängste und Unsicherheit zu transzendieren und das transformative Potential zu erleben.„
Auch eine akzeptierende Haltung sei wichtig, dem Unvermeidlichen nicht widerstehen zu wollen.
Am schönsten sei es natürlich, die tiefe Wandlungskraft des Todes ein Stück weit erleben zu können, ohne tatsächlich zu sterben. Dafür sei es wichtig, uns eben frühzeitig im Leben immer wieder bewusst an unsere Sterblichkeit zu erinnern.
Dem Tod immer wieder begegnen
Was könnte sich dafür besser eignen als die tägliche, gefühlsbetonte Wahrnehmung und Verbindung zur Natur um uns herum – die ja in einem beständigen Prozess des Werdens UND Vergehens und Sterbens existiert.
In dieser Jahreszeit, dem grauen, kalten, dunklen Spätherbst ist dies besonders deutlich spürbar. Nicht ohne Grund ist es die Zeit der Toten- und Ahnenfeste und auch die Zeit in der wir unser Trauer-Feuer feiern (im nächsten Jahr wieder).
Was könnte uns eindrücklicher an unsere eigene Sterblichkeit erinnern als mit zu erleben, wie fast alles Leben verschwindet und sich tief in den Schoß der Mutter Erde zurück zieht?
Noch eine Beobachtung: Eine Studie in den Niederlanden hat gezeigt, dass die Selbstmordrate sinkt, wenn viel „Grün“ am Lebensort zugänglich ist.
Vielleicht könnte dies damit zu tun haben, dass Natur uns auch immer wieder vorlebt, wie selbst nach dem tiefsten Winter und der größten Kälte neues Leben geboren wird?

28. Spiritualität spüren in der Natur
Naturverbindung bedeutet, die Welt da draußen nicht nur als Um-welt zu sehen, als Reservoir für wertvolle, dem Menschen nützliche Ressourcen, das wir schützen und managen sollten. Sie ist auch nicht nur Erholungsraum, XXL-Fitnessstudio oder malerische Kulisse für unsere ästhetischen Gelüste.
Durch die Vertrautheit mit Orten und ihren Lebewesen können wir viel mehr auch eine tiefe emotionale Bindung entwickeln, die nicht nur Kindern ein Gefühl des verwurzelt und gehalten seins in der Welt schenken kann.
Ebenso ist es möglich, noch einen Schritt weiter zu gehen, wenn wir uns der Möglichkeit öffnen, dass die gesamte Welt, in der wir leben, beseelt sein könnte.
Eine Grundsäule der Naturverbindungspraxis ist es, uns in ein spirituelles Zwiegespräch mit unserer Mitwelt zu wagen, so wie es Menschen seit dem Anbeginn der Zeiten in allen Teilen der Erde getan haben – vielleicht sogar schon die Neanderthaler, worauf ein schier unfassbarer, etwa 170.000 Jahre alter Fund in einer Höhle in Frankreich hinzudeuten scheint.
Die Vermutung liegt sehr nahe, dass die Voraussetzungen für spirituelles Erleben ein Teil der menschlichen biologischen Grundausstattung sind. Für mich bedeutet dies vor allem, in Verbindung mit etwas sein zu können – und zu wollen – das mehr ist als das physisch in jedem Moment Wahrnehmbare.
Können wir das Unhörbare erlauschen lernen, das Unsichtbare sehen lernen?
Für mich sind die Wurzeln der menschlichen Spiritualität in unseren Fähigkeiten begründet: mentale „Zeitreisen“ durchzuführen, allein mit unserer Vorstellungskraft etwas „in den Raum zu holen“ und zudem über unsere „normalen“ Sinne, aber auch unser „Bauchgefühl“ und andere Nervengeflechte im Körper Sinnesreize wahrzunehmen und mit Hilfe unseres großartigen Großhirns, vor allem des Stirnlappens zu interpretieren – ein Teil von dem was wir „Intuition“ nennen könnten.
Wir Menschen „können“ Spiritualität, und die Existenz unzähliger spiritueller Traditionen überall auf dem Erdball weist darauf hin, dass wir sie vielleicht sogar brauchen, es zumindest in vielen Personen ein Bedürfnis danach gibt.
In Mitteleuropa ist ein Begriff, der in zahlreiche Mythen und Sagen auftaucht, die „Anderswelt“. Natürlich weiß niemand ganz genau was die Anderswelt ist oder könnte eine Theorie dazu beweisen – für mich ist eine mögliche Deutung, dass der Begriff für eine weitere Ebene zur Welt des Sichtbaren, in die Einzutauchen ein noch intensiveres und auch anderes Erleben eines Ortes, seiner Wesen und auch von uns selbst bedeutet.
Die Anderswelt zu besuchen könnte beispielsweise bedeuten, Melodien oder Flüstern im Wind zu erlauschen, an einem Ort etwas Geheimnisvolles zu erspüren oder uns Menschen ganz nah zu fühlen, die in dieser Welt schon verstorben sind und insgesamt unserem eigenen Wesenskern und dem Wesen der Welt ein bisschen näher zu kommen.
Auch das Wahrnehmen der Lebenskräfte, die allem innewohnen, des Göttlichen oder einer Liebe in den Orten und Lebewesen kann ein Ausdruck unserer spirituellen Beziehung zur Landschaft sein.

29. Spiritualität kann Halt geben
Zahlreiche wissenschaftliche Berichte deuten daraufhin, dass Spiritualität sich positiv auf die seelische Gesundheit von Heranwachsenden auswirkt.
In einer Studie zeigten Dialyse-Patient*innen in deren Leben Spiritualität oder Religiösität eine große Bedeutung hat, ein niedrigeres Risiko für Selbstmord und allgemein bessere seelische Gesundheit.
Eine andere Studie kam zu dem Schluss, dass Spiritualität oder Religiosität allgemein für Menschen mit chronischen Erkrankungen Linderung ermöglichen könnten, sie insbesondere dabei unterstützen, Bedeutung zu verleihen, Zuversicht zu bewahren und eine Gefühl von innerem Frieden zu erleben.
Einige Forscher vermuten, dass für die positiven Auswirkungen insbesondere das Eingebundensein in ein religiöses System positive Auswirkungen hat.
Die britische Mental Health Foundation kommt zu dem Schluss, dass Spiritualität vor allem dann hilfreich sein könne, wenn sie die persönliche Selbstermächtigung unterstütze, Vielfalt bekräftige und umarme, und die Wichtigkeit von Hoffnung, Vergebung und Sinnhaftigkeit unterstreiche.

30. Die eigene schöpferische Kraft stärken durch Kontakt zur Natur
Eine mögliche Erfahrung für Selbstermächtigung kann es sein, uns nicht nur als Teil der Schöpfung zu erleben, sondern uns selbst als zutiefst schöpferische Wesen zu erfahren.
Überall auf der Erde wo Menschen leben ist Kultur entstanden, und aus dem schöpferischen Wirken erwuchsen (und tun dies heute noch) kulturelle Elemente, Kulturgüter und Schätze, wie Lieder, Geschichten, Poesie, Gegenstände, Kunstwerke, Kochrezepte, Rituale und Bräuche.
Auch die Art und Weise, wie wir Orte gestalten, Pflanzen kultivieren, Behausungen bauen und Räume einrichten, technische Geräte erfinden oder neue Methoden um dies und jenes zu vollbringen entwickeln und verfeinern sind möglich durch unseren Erfindungsgeist und die Fähigkeit, immer wieder Neues hervorzubringen.
Und kreativ sein tut uns gut:
Eine Studie mit jungen Studierenden in der Woche vor ihren Abschlussprüfungen zeigte, dass selbst eine kurze schöpferisch-künstlerische Tätigkeit ihre Anspannung und Ängstlichkeit gravierend verbessern konnte (verglichen mit einer Kontroll-Gruppe, die in der Zeit keine Kunst betrieben).
In Interviews mit Menschen die kreative Berufe ausüben wurde festgestellt, dass Natur sich bestärkend auf deren Kreativität auswirke, vor allem in den ersten beiden Phasen eines schöpferischen Prozesses, nämlich der Vorbereitung und der Inkubation (dem Ausbrüten der Inspiration.)
Auch die Verknüpfung von künstlerischen Aktivitäten und Natur konnte in Studien als deutlich unterstützend für das seelische Wohlbefinden von Menschen erprobt werden, die sich in psychologischer Behandlung befanden.
In den USA gibt es einen Test, um das kreative Potential einschätzen zu können, wobei gemessen wird, wie viele Einfälle die Personen zu assoziativen Fragen haben. Studierende, die ihren Test nach vier Tagen Outdoor-Zeit machten erreichten 50% höhere Ergebnisse als die Kontrollgruppe, die vor der Wandertour getestet wurden.
Kreativität lebendig halten
Viele Forschende gehen davon aus, dass Kreativität nicht im Laufe des Lebens erlernt wird – sondern vielmehr verlernt.
1968 starteten George Land und Beth Jarman eine Langzeitstudie, für die sie 1.600 5-jährigen einen Kreativitätstest machen ließen – welcher von der NASA genutzt wurde, um innovative Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen zu finden. Das erstaunliche Ergebnis war, dass 98% der Kinder als „hoch kreativ“ abschnitten.
Dieselben 1.600 Kinder wurden im Alter von zehn Jahren erneut getestet – diesmal erreichten nur noch 30% von ihnen den „hoch kreativen“ Bereich und mit 15 Jahren schaffen es nur noch 12% von ihnen.
Das Ergebnis wurde mit dem von 280.000 Erwachsenen verglichen, die den Test auch absolviert hatten, und von denen nur 2% als „hoch kreativ“ abgeschnitten hatten.

Was ist eigentlich Kreativ?
Beim Begriff Kreativität denken viele Menschen erst einmal an Malen, Basteln oder andere Formen von künstlerischem Ausdruck.
Dabei kann alles was wir erschaffen von Kreativität getränkt sein: Das Essen, das wir kochen, die Art und Weise wie wir Geschirr abspülen, unseren Garten bestellen, unserer beruflichen Tätigkeit nachgehen, welche Projekte und Initiativen wir in die Welt bringen und auch wie wir innerhalb der schon existierenden Projekte und Lebenskontexte uns verhalten.
Wenn wir uns mit der Natur verbinden, können wir einen Zauber darin entdecken, wie besonders jedes Wesen ist (zum Beispiel die vielgestaltigen Insekten!) und wie einzigartig sein Beitragen zur gesamten Lebensgemeinschaft ist.
Neben dem inneren Zustand von entspannter Aufmerksamkeit, den uns das draußen sein ermöglichen kann, sind wir umgeben von zahllosen Türchen hinter jeder von denen Inspiration auf uns wartet, die uns nicht nur in Staunen und Ehrfurcht versetzen könnten, sondern auch anregend auf unsere Kreativität sind.
Menschen waren schon immer kreativ
Selbst in den ältesten menschlichen Kulturen, bei Jäger und Sammler Völkern, spielt Innovation eine große Rolle – was sicherlich ein Hauptgrund dafür ist, dass sie auch in den unwirtlichsten Gegenden der Erde leben, gedeihen und die Fruchtbarkeit und Artenvielfalt der Landschaft erhalten können. Immerhin findet sich 80% der Biodiversität der Erde in den nur 25% der Landmasse ausmachenden Regionen, die von indigenen Völkern bewirtschaftet werden.
Forschende beschreiben, dass Jäger-Sammler-Kinder vorwiegend durch selbstbestimmtes Entdecken lernen würden, durch Spiel und Ausprobieren von immer neuen Möglichkeiten, wobei Gleichaltrige und Erwachsene auch Wissen weitergäben – was beste Voraussetzungen für innovatives Verhalten seien.
Meine Erfahrung im Bezeugen von Naturhandwerks-Projekten ist, dass egal ob wir Rasseln bauen, Löffel schnitzen oder Körbchen flechten – die Natur mit ihrer ungeheuren Vielgestaltigkeit (auch in den verwendeten Materialien) unserer eigenen Kreativität kräftig unter die Arme greift!
Denn jedes einzelne gefertigte Ding, egal sogar wie viel Unsicherheit, Frust und Zweifel im für viele Menschen ungewohnten Herstellungsprozess durchlebt wurden, ist am Ende ein faszinierendes Unikat, einfach etwas ganz Besonderes – so wie die Person, die es gemacht hat.

31. Besondere Begegnungen in der Natur
Wenn wir unsere Verbindung zur Mitwelt nähren und stärken, stellen wir die Weichen für besondere Begegnungen, die überraschend un unvergesslich sein können. Nicht selten geschehen sie in Momenten, wenn Menschen sie auch gerade dringend gebrauchen können.
Es kann eine Gipfelerfahrung werden, wenn sich ein Schmetterling auf mich setzt, oder eine Biene mich besucht, oder der Wind in genau dem „richtigen“ Moment auffrischt und mir deutlich übers Haar streicht, oder ein fast unmerklich zarter Regen in winzigen Tropfen mein Gesicht benetzt.
Und manchmal passieren Ereignisse, die so ungewöhnlich oder besonders erscheinen, dass sie kaum zu glauben sind: Ein wilder Iltis beschnuppert uns, ein Mauswiesel hüpft uns auf den Schoß, ein Fuchs oder Reh legen sich im Wald ganz nah bei uns schlafen, wir spüren den Flügelschlag eines Vogels auf der Haut, seine Federn die uns im Vorbeifliegen berühren, oder ein Dachs läuft auf seinem Weg dreist mitten unter unseren Beinen hindurch…
Solche Geschichten können zu lebenslangen Erinnerungen werden, die dem draußen Sein und unserm gesamten Leben einen gewissen Zauber verleihen können.
Es sind Erlebnisse, die wie Schätze funkeln, von vielen Menschen auch wie Schätze gehütet werden und uns in Momenten wo wir uns einsam und verlassen fühlen helfen können, eine sanfte Wärme zurück in unser Bewusstsein zu holen, verbunden mit der Erinnerung daran, dass uns einmal so viel Glück zuteil wurde – und vielleicht schon bald wieder wird.

Auf die Verbindung kommt es an
Je näher ich mich meinen Mit-Wesen fühle, desto stärker wirken die ohnehin wohltuenden Effekte des Draußenseins auf mich. In einer Studie von 2014 wurde für Menschen durch Befragung der Grad ihrer „Nature Relatedness“ ermittelt und dann festgestellt, dass die Personen mit stärkerer Naturverbundenheit deutlich weniger unter Ängsten litten.
Nature Relatedness wird beispielsweise auf folgende Weise ermittelt: Teilnehmende beantworten die Frage: „Wie verbunden bist du gerade mit der Natur?“, indem sie eines von sieben Bildern mit je zwei Kreisen auswählen, wobei einer der Kreise das Wort „Selbst“ enthält, der andere das Wort „Natur“. In jedem Bild sind die beiden Kreise etwas anders zueinander positioniert, stehen vollkommen eigenständig da oder überlappen einander, das letzte Bild symbolisiert dabei ein vollständiges Verbundensein („interconnectedness“) von Natur und Selbst.
Eine Beziehung zur Natur scheint es wahrscheinlicher zu machen, dass Menschen überhaupt rausgehen und Grünräume besuchen – und das draußen sein wiederum kann unser Gefühl, in Beziehung mit der Mitwelt zu sein verstärken.
Miles Richardson und die von ihm begründete Nature Connectedness Research Group in Großbritannien erforschen seit dem Jahr 2000 die Auswirkungen einer bewussten Verbundenheit mit der Natur.
Bewusstseins-Zustand für das Inter-Verbundensein
In einem Artikel über ihre Arbeit wird Naturverbindung („Connectedness with Nature„) als ein „fortdauernder Bewusstseinszustand, welcher miteinander verknüpfte kognitive, affektive und erfahrungsbasierte Merkmale aufweist, die gekennzeichnet sind durch konsistente Einstellungen und Verhaltensweisen eine nachhaltige Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für das Inter-Verbundensein zwischen dem eigenen Selbst und dem Rest der Natur„.
In der Auswertung von 50 Studien, in die über 16.000 Menschen einbezogen wurden, haben sie nachweisen können, dass Naturverbindung unter anderem zwei ganz grundlegende Aspekte zum Glücklichsein verstärke: Eudaimonie (eine tiefe Freude, die sich bei sinnhaftem Wirken einstellt), und ebenso auch ein stärkeres Erleben von persönlichem Wachstum.
Gemeinsam mit vielen anderen Organisationen in Großbritannien haben sie einen nationalen Indikator für Naturverbindung entwickelt, den Nature Connectedness Index.
Für Menschen in städtischen Lebensräumen stellten sie für eine weitere Studie eine App zur Verfügung, die mehrmals täglich Impulse gab, im jeweiligen Moment etwas von der Natur in der Stadt und das Gute daran bewusst wahrzunehmen.
In einer begleitenden Studie konnte gezeigt werden, dass sowohl direkte, als auch über den Zeitraum eines Monats fortdauernde Verbesserungen für seelische Gesundheit und Wohlbefinden für die teilnehmenden Personen erreicht werden konnten.
Für mich weisen die Ergebnisse der Nature Connectedness Forschungen darauf hin, dass all die ohnehin positiven Effekte des Natur-Kontakts vielleicht umso intensiver wirken, je stärker wir uns Natur mit unserer Mitwelt verbunden fühlen und uns dessen gewahr sind, dass wir selbst ein Teil davon sind.

Gut für alle!
Das wunderbarste ist vielleicht, dass all das, was uns also so richtig gut tut, ganz klar auch den „anderen“ nutzt. Von Teilnehmenden in einer Studie die sogenanntes „Umweltwissen“ erwarben, also neue Informationen darüber, was der Natur nutzt oder schadet, ließen sich nur 2% der Personen davon so beeindrucken, dass sie ihr umweltschutz-relevantes Verhalten dadurch veränderten.
Wuchs jedoch ihre Verbindung zur Natur, waren ganze 69% der teilnehmenden Menschen bereit, ihr Alltagsverhalten zugunsten des Umweltschutzes zu verändern.
Naturverbindung wurde somit als ein verlässlicher Vorbote für verantwortungsvolles Umweltverhalten beschrieben.
Lerne andere Menschen auf ihrem Lern- und Lebensweg zu begleiten:
Die Empfehlungen in diesem Text ersetzen keine therapeutische Begleitung.
Wenn du das Gefühl hast, unter Angstzuständen, Depressionen oder anderen schwer auszuhaltenden seelischen Zuständen zu leiden – wisse, du bist nicht allein!
Hilfe bekommst du bei zugelassenen Psychotherapeut*innnen, beispielsweise den hier im Verzeichnis aufgeführten Personen, vielleicht auch in deiner Region: https://www.somatic-experiencing.de/traumatherapeuten-finden/

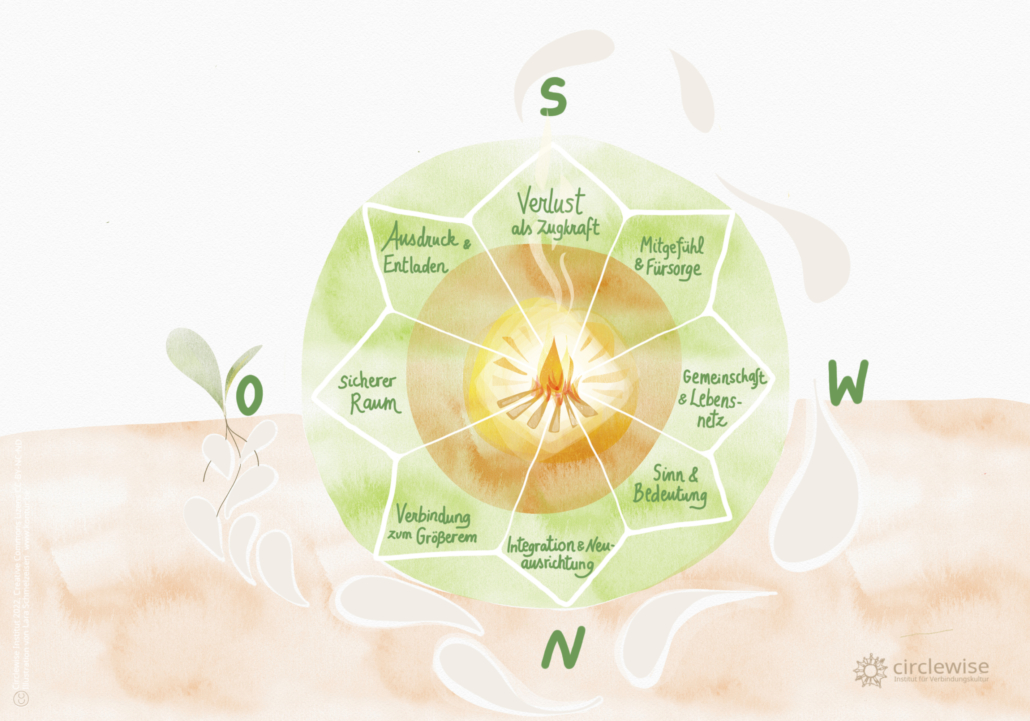 (C) Circlewise Institut 2022, Creative Commons Lizenz CC-BY-NC-ND, Illustration von Lara Schmelzeisen https://kontur.be
(C) Circlewise Institut 2022, Creative Commons Lizenz CC-BY-NC-ND, Illustration von Lara Schmelzeisen https://kontur.be



 Steve Sanchez Photos / Shutterstock.com
Steve Sanchez Photos / Shutterstock.com







































